Seinen Platz als frühestes verbliebenes Beispiel für die Verwendung der im 17. Jahrhundert hochmodernen Gitarre als Soloinstrument mit einem größeren Ensemble behauptet das Concerto grosso in D-Dur für 2 Violinen, Gitarre oder Laute und Streicher von Alessandro Stradella (1639 – 1682). Dessen illustres und hochproduktives Leben wie seine Ermordung in Genua auf offener Straße gab im übrigen noch Anlass zu einer 1844 in Hamburg uraufgeführten und mit seinem Namen titulierten Oper Friedrich von Flotows.

Ihm folgten dank der Kompositionen von Sylvius Leopold Weiss und Antonio Vivaldi, als das Solokonzert – auch mit Violine, Oboe, Fagott oder Cembalo – seine erste Blütezeit erlebte, weitere bedeutende barocke Gitarren- oder Lautenkonzerte. Auch Johann Friedrich Faschs Werke und die des Virtuosen Adam Falckenhagen ließen sich hier einreihen, wenn man die Laute als Vorgänger und Verwandten akzeptiert. Die vielfältige Aufgabe des mehrstimmigen Instruments im und vor dem Orchester ist besonders in der polyphonen Literatur der Zeit gut nachzuvollziehen: das Zupfinstrument als Harmonie- aber auch Melodieträger, als Rhythmusgeber aus seinen Anfängen als Continuo-Partner sowie als exotisch empfundene neue Klangfarbe in der Konsonanz mit den Streichinstrumenten.

Einem breiteren Hörerpublikum sind heute die Ende des 18. Jahrhunderts und im frühen 19. entstandenen, ganz und gar von der italienischen Variante der Wiener Klassik bestimmten Konzerte von Luigi Boccherini und Mauro Giuliani (1781 – 1829) vertraut: Gerade die zwei Concerti in A-Dur und das für Terzgitarre vorgesehene in F-Dur des hochbegabten, in Wien, Venedig, Rom und Neapel wirkenden Gitarrenvirtuosen erfreuen sich im Konzertsaal bis heute ungebrochener Beliebtheit. Der Neapolitaner Ferdinando Carulli (1770 – 1841) trug zu dem immer noch jungen Genre durch sein Concerto in A-Dur, komponiert um 1820, ebenso bei wie durch ein Doppelkonzert für Flöte, Gitarre und Orchester, das etwa 1825 zu datieren ist. Die „Geniezeit“ des Gitarrenkonzerts zwischen Rokoko und Wiener Klassik reichte – stilästhetisch betrachtet – jedoch kaum bis in die romantische Periode hinein.
Seine Popularität setzte im Grunde erst im 20. Jahrhundert wieder ein, wobei sowohl Beiträge von spanischer und mexikanischer als auch polnischer Seite eine größere Rolle spielen. Włodzimierz Kotoński (1925 – 2014), eigentlich ein Pionier der avantgardistischen elektronischen Musikszene, schrieb 1960 sein Concerto per quattro mit Streichern in der ungewöhnlichen Solistenbesetzung für Klavier, Cembalo, Harfe und Gitarre. Damit setzte er die Tradition gerade des Gitarrenkonzerts fort, das von der Kontrastierung des gestrichenen mit dem gezupften mehrstimmigen Klang lebt. In etlichen Gitarrenkonzerten liefert darüber hinaus das Streicher-Pizzicato zum Schlag- und Zupfsound der Gitarre eine aparte Ergänzung. Kotońskis älterer polnischer Kollege Alexandre Tansman (1897 – 1986) trug im selben Jahr 1960 mit seiner Musique de Cour für Gitarre und Kammerorchester zu dieser Gattung bei, wobei ihm eher eine Hommage an eine kulturell feinsinnige, höfische „hohe Zeit“ vorgeschwebt haben mochte, als noch Boccherini und Carulli an europäischen Fürstenresidenzen spielten.
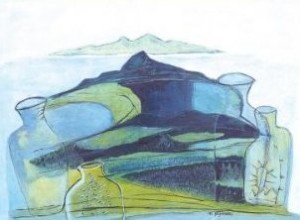
Für Furore sorgten im vergangenen Jahrhundert natürlich auch Manuel de Ponces mexikanisch-feuriges Concierto del Sur und Joaquín Rodrigos – zum Beispiel durch die Brüder Romero – weltweit gespieltes elegisches Concierto de Aranjuez. Der Brasilianer Leo Brouwer trug ebenso Wesentliches zur Gattung bei. Zwei Gitarrenkonzerte schuf der US-amerikanische Komponist Alan Hovhaness (1911 – 2000) mit armenischen Wurzeln, der insbesondere hinsichtlich der Melodieführung gelegentlich auf die alten Tonarten und Melodiefloskeln des südosteuropäischen Herkunftslandes des Vaters und seine für unsere Ohren nicht immer gewohnten, teils chromatischen Intervallbildungen zurückgreift.
In seinem Concerto for Guitar and Strings no. 2 von 1985 konfrontiert Hovhaness die Gitarre mit einem abschnittsweise nur leise aus dem Hintergrund unterstützenden (und häufig „pizzicato“ spielenden) Streicherapparat als Resonanz- und Rhythmusfläche. In seiner harmonischen Faktur verbleibt das reizvolle Konzert ansonsten weitgehend in den konventionellen Bahnen der klassischen Konzertliteratur. Davon liegt eine Aufnahme von Javier Calderón an der Gitarre mit dem Royal Scottish National Orchestra unter Stewart Robertson bei Naxos vor (B00G2HR21A).
Schreibe einen Kommentar