Wie der Pianist und Violinist William Vincent Wallace war auch der zweitplatzierte „Teufelsgeiger“ John Phillip Deane aus Irland auf den fünften Kontinent eingewandert, blieb aber seiner neuen Heimat länger treu und zog in späteren Jahren noch einmal an seinen früheren Wohnort Hobart zurück. Seine Karriere nahm ihren eigentlichen Anfang aber in Sydney. Dorthin hatte die Familie nach einer kurzzeitigen Gefängnisstrafe, die Deane zu verbüßen hatte, ihren Wohnsitz verlegt. Nach seinem spektakulär erfolgreichen Konzert am 18. Mai 1836 im Royal Hotel der Stadt, zu dem sein neunjähriger Sohn das Cello spielte und große Aufmerksamkeit auf sich zog, hatten die Deanes sich endgültig einen Namen gemacht. Dabei hatte ihre Musikschule, an der nicht nur verschiedene Instrumente unterrichtet wurden, sondern auch Theorie, bereits Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
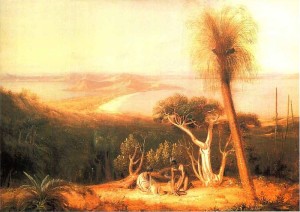
Diese Institution stand in Konkurrenz zu der von William Wallace geleiteten Musikakademie, konnte aber mit günstigeren Preisen für die nicht immer betuchten Schüler aufwarten. In Folge gab John Phillip Deane selbst regelmäßig Konzerte und kann zu Recht als Begründer der australischen Kammermusiktradition gelten, die noch Peter Sculthorpe beeinflusste, als er 1978 zum Gedenken ein Trio für die originale Besetzung mit zwei Violinen und Cello in seine neue Streicherkomposition Port Essington integrierte.
Die Berufskonkurrenten Wallace und Deane schufen mit ihrer gemeinsamen Stiftung der Sydney Philharmonic Society schließlich die Voraussetzungen für das heute lebendige und weltweiten Ruf genießende Musikleben der Stadt. Ein unwesentlich älterer britischer Einwanderer, Isaac Nathan (1790 – 1864), übernahm einige Jahre später als Dirigent das neu gegründete Orchester. Der Freund Lord Byrons stammte eigentlich aus Polen und zeigte sich – wohl nicht zuletzt aufgrund einer dreifachen interkulturellen Prägung – als einer der ersten Weißen von der indigenen Musik angezogen. Aus Forschungsreiseberichten ins Landesinnere bezog Nathan den Stoff für seine Kantatentexte. Die frühe Verarbeitung von Melodien der Ureinwohner, die er transkribierte, brachte ihm schließlich den Ruf des Urvaters (genuin) australischer Musik ein.

Nathans Oper Don John of Austria zu einem nicht selten vertonten historischen Stoff europäischer Tragweite wurde 1847, sechs Jahre, nachdem dieser australischen Boden zuerst betreten hatte, zum Anlass ihrer Uraufführung im Victoria Theatre nachhaltig applaudiert. Nicht zuletzt war es Nathans Verdienst, Mozarts und Beethovens Werke in Sydneys Konzertrepertoire durch zahlreiche Auftritte etabliert zu haben. Darüber hinaus verwurzelte er mit seinen Hebrew Melodies jüdische Musik im internationalen Musikleben und vertonte Lyrik der australischen Schriftstellerin Eliza Hamilton Dunlop in Liedern.
Schreibe einen Kommentar