Erst im Jahr 2010 wurde das junge Ensemble Stile Galante von seinem Leiter Stefano Aresi aus der Taufe gehoben. Aresi selbst hat seit nicht langer Zeit ein musikologisches Doktordiplom der Universität Pavia in der Tasche, ist aber schon häufig als wissenschaftlicher Berater bekannten Ensembles der Alte-Musik-Szene zur Seite gestanden, mit einem besonderen Fokus auf die späte Barockzeit. Unter seinen Klienten waren bisher die Accademia Bizantina, Il Giardino Armonico, Ensemble 415, La Venexiana oder L’Arpeggiata. Zu den Musikern seiner eigenen Gruppierung zählen die Geigerinnen Claudia Combs und Eva Saladin, der Theorbist Gabriele Polomba, Agnieszka Oszańca am Violoncello und der Cembalist Andrea Friggi. Auf der aktuellen CD gesellt sich als Protagonistin die Mezzo-Sopranistin Marina De Liso hinzu.
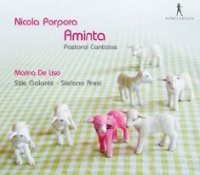
In vielen der Schäferkantaten von Nicola Antonio Porpora (1686 – 1768), einem gefährlichen Konkurrenten Händels aus neapolitanischer Schule, geht es um die Klage einer Hirtin oder eines Schäfers um eine verlorene, trügerische oder unerfüllte Liebe, wobei aber die Bestandteile einer ordentlichen klassischen Schäferidylle in den Liedtexten des 18. Jahrhunderts nur mehr ein Hintergrundszenario abgeben.
„Die Naturbeschreibung hat dort lediglich die Aufgabe, den Kontext begreiflich zu machen, in dem das Stück spielt“, schreibt Aresi selbst zur Auswahl auf der vorliegenden CD-Neuerscheinung.
Dabei wählt der Lieddichter einen jeweils zur Gefühlslage der agierenden Personen, meist einer Nymphe und eines Hirten oder der umgekehrten Konstellation, passenden landschaftsmetaphorischen Rahmen: In „Freme il mar, e col sussurro“ wird in den ersten Versen die See mit ihrem Strand präsentiert, wobei in der letzten Strophe aber auch die Turteltaube als Liebesvogel einfliegt. In „Ninfe e pastor“ ist es das Ufer von Sebeto, einem realen Ort, während im Kontrast zu den ersten in „Questa dunque è la selva“ ein dunkler Wald die Hintergrundfolie darstellt, denn die Schäferin zürnt in schwarzer Melancholie dem untreuen Liebhaber Aminta, der sie verließ. Versöhnlich wirkt hier nur die Erinnerung an einen lichten Platz im Wald, wo sich die Liebenden trafen: „Care piante, amato rio…“
Musikalisch herrscht Grazie in der gesanglichen wie instrumentalen Agogik und dynamische Zurückhaltung. Der Ausdruck soll sich möglichst dem lyrischen Ideal annähern, auf opernnahe Expressivität wird daher weitestgehend verzichtet, der schlichte Ton entspricht einem Genre, das seinen besonderen Nischenplatz in der Musik des frühen 18. Jahrhunderts behauptete. „Stile Galante“ bedeutet für die Musizierenden hier, sich ganz dem Gefühl der Akteure auszuliefern, ohne die Grenzen des empfindsamen und in feinen Registern abgestuften Liedduktus zu übersteigen. Dazu fügt sich stilistisch ein sehr kontrolliert ausgeführtes Schweben zwischen elegantem Portato und munterem Fließen in den belebten Dur-Passagen. Ebenso gilt dies für das vom Solisten brillant akzentuierte Cellokonzert in F-Dur, das zur Abrundung dem Vokalprogramm der Einspielung hinzugefügt wurde und das nicht selten an die Konzerte des – wie Porpora – in Neapel geborenen Komponisten Leonardo Leo (1694 – 1744) für das Instrument erinnert, diese allerdings an originellen Einfällen nicht selten übertrifft. Auf einem klangschönen Cembalo werden Partimenti aus der Werkstatt Porporas im Geist des Spätbarock ausgeführt hinzugefügt.
Schreibe einen Kommentar