Wagten sich abenteuerlustige Forscher wie Roald Amundsen, Autor der Nordwestpassage und Knud Rasmussen, Verfasser der Grönlandsaga, ganz bewusst physisch an die Grenzen der nördlichen Welt heran, blieb für viele Komponisten auswärts der Norden oft lediglich eine ferne, durch Kälte, Eis, Schweigen und Leere geprägte Projektionsfläche ihrer Kunst.

Heute versuchen sich im Bereich der Popularmusik etliche Musiker an einer vorgeblich auf Wikingerart martialisch gehämmerten oder von Heldenromantik getragenen eigenwilligen Deutung Skandinaviens und des Nordens an sich; beispielsweise profitierte die Formation Santiano (nicht nur vor sieben Jahren) von den septentrionalen Klischeebildern, die wir mit uns herumtragen.
Zum regelrechten Apologeten nordischer Programmatik wurde neben Edvard Grieg (mit der Peer Gynt Suite) sein finnisches Pendant Jean Sibelius: Sein Schaffen kreist schon früh thematisch beharrlich um die Kalevala-Mythen, begonnen mit einer dem Heros Kullervo gewidmeten Symphonie für Sopran, Bariton, Chor und Orchester (1892), dem unmittelbar die symphonische Dichtung En saga folgte. In beiden nimmt er bewusst keine Anleihen bei der finnischen Volksmusik, erfindet praktisch seine eigene, dem nordischen Sujet angemessene Tonsprache.
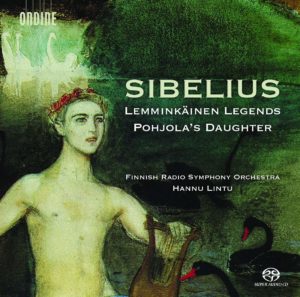
Der heimischen Landschaft und ihren Repräsentationen gilt die ein Jahr später entstandene Karelia-Suite. Auch die Jahre später, zwischen 1913 und 1914 komponierte symphonische Dichtung Der Barde verdankt sich in der Adaption eines Gedichts von Johan Ludvig Runeberg dem von MacPhersons fiktiver Ossian-Figur getragenen Klischee des einsamen, mythisch verklärten Harfenspielers aus den „unwirtlichen“ Regionen Europas. Noch Tapiola (1926) arbeitet sich am finnischen Ur-Mythos ab.
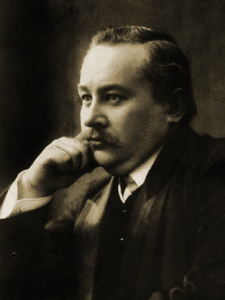
Sibelius‘ unwesentlich jüngeren Zeitgenosse Oskar Merikanto, der 1868 in Helsinki geboren wurde, beschäftigten zunächst gleichfalls nordische Landschaften und die in ihnen verorteten Mythen: Motiven der Kalevala entspringt sein Singspiel Pohjan neiti (1899) auf Basis eines Librettos Antti Rytkönens. Im Jahr darauf schuf er die Schauspielmusik Tukkjoella („Holzfäller am Fluss“), die mit romantischem Impetus das Leben in der heimischen Natur schildert. Ebenso ist das dramatische Geschehen für das Kammermusikstück Merellä („Am Meer“) deutlich von Bildern des Nordens geprägt.