Man muss nicht erst an Ottmar Ettes Erkenntnisse über die subtile kommunikative Vernetzung der insularen Inselwelten erinnern, um zu der Vermutung zu gelangen, dass sich die Karibik als musikalisches Programm zuallererst und überwiegend aus den eigenen Ressourcen entwickelte, sprich: aus den indigenen, später auch afrikanischen und gleichzeitigen kolonialeuropäischen Tänzen, Gesängen sowie aus deren melodischen, harmonischen und rhythmischen Traditionen. Was mit den Piratenfilmen aufkam und seinen vorläufigen phantasmagorischen Höhepunkt in Hans Zimmers Filmmusik zum Fluch der Karibik fand, ist hingegen von der vergangenen wie gegenwärtigen kulturellen Realität völlig entrückt.

Das Fabulieren über eine nicht persönlich erfahrene Karibik reicht, wenigstens was deren mexikanischen Anteil betrifft, in der Musikgeschichte weit zurück: Hier kann man an Antonio Vivaldis Oper Montezuma, abgeschlossen 1732 in Venedig, denken, aber auch an kurz danach unternommenen Deutungen dieses Stoffes, der in ganz Europa dank Interesses am Exotischen im Kielwasser der Aufklärung über den „edlen Wilden“ en vogue war.
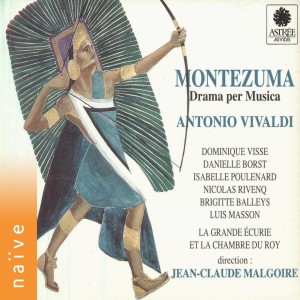
Carl Heinich Graun schrieb am preußischen Hofe in spätbarocker, mit dem Melos des vorklassischen Stils untermischter Manier 1755 ein dreiaktiges Musikbühnendrama gleichen Titels. Dessen Besonderheit liegt darin, dass der flötenspielende und dem Krieg gleichermaßen nicht abgeneigte König Friedrich II., der ein begrenztes Interesse auch für ferne Kontinente hegte, das Libretto zu der glücklicherweise erhaltenen Oper verfasst hatte. Die geheimnisvolle Seite der karibischen Welt spielt im übrigen selbst noch in Theodor Storms Novelle Von Jenseits des Meeres (1865) über eine mysteriöse, von der Insel St. Thomas abstammende Mulattin eine gewichtige Rolle, wobei ein französischer Kupferstich zu Jaques-Henri Bernardins de Saint Pierre allerdings auf Mauritius, nicht in der Karibik angesiedeltem Roman Paul et Virginie (1788) als Bildreferenz dient.
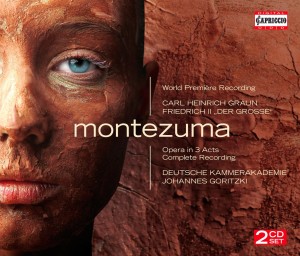
Zurück zu Zimmers Klangfolie für die Erfolgsreihe Fluch der Karibik: Immerhin setzt man in der kommerziellen Musikindustrie, wenn das (erweiterte) Symphonieorchester genutzt wird, auf die drei Prinzipien der Programmmusik, nämlich auf die Nachahmung von (Natur-)Lauten inkl. Papageiengeplapper, nahezu überflüssig zu erwähnen: auf die Ansprache des Gefühls und auf die Wiedererkennung von Leitmotiven, auch wenn diese mit der folkloristischen karibischen Musik hier sehr wenig zu tun haben. Unsere eingeschränkte Empfehlung gilt in der Adventszeit (notgedrungen) auch für eine Mischmasch-Veröffentlichung wie die CD Karibische Weihnachten mit Mr. Hurley und den Pulveraffen, denn hier scheint es sich wenigstens um einen parodistischen Wurf zu handeln …
Schreibe einen Kommentar