Leider fehlt jeder geeignete Anhaltspunkt dafür, aus welchem Anlass heraus der so produktive und geschickte Vermarkter seiner selbst, Antonio Vivaldi, in solchem Maße der von ihm erfundenen Gattung des Fagottkonzerts zuarbeitete. Es liegen aus seiner Hand 39 elaborierte Konzerte vor, die damit noch weit hinter der Zahl derjenigen mit solistischem Violinpart zurückbleiben. Dennoch handelt es sich gewissermaßen um eine große Kuriosität der Musikhistorie, denn bis der „prete rosso“ oder ein anderer auf die Idee kam, war das Fagott nicht mehr als ein marginales Instrument im Bestand der Basso-continuo-Gruppe, ergänzte also Gambe und Cembalo; bis zum allerersten Konzert Vivaldis, das wohl kurz vor oder nach 1730 entstand, wurde es in tragender Rolle nicht akzeptiert, und dies, obwohl seine Klangfarbe – wenigstens aus heutiger Perspektive – komplementär sehr gut zum eher höhenlastigen Streicherensemble oder -orchester passt. Als eines der frühesten Werke dieser Art gilt RV 488 in der Tonart B-Dur; es könnte auch schon deutlich vor 1730, aber nicht früher als 1710 entstanden sein.

In der Zeit, als Vivaldi die Fagottkonzerte niederschrieb, arbeitete er als Musiklehrer am Ospedale della Pietà, einer gemeinnützigen venezianischen Einrichtung für Waisen. Gerade das scheinbar unscheinbare Repertoire des Fagottkonzerts wurde für ihn zu einem Experimentierfeld der Ausdrucks- und Erfindungskunst, in dem er sich richtig „austoben“ konnte.

Es finden sich sowohl lyrische, als auch elegische und nicht zuletzt dramatische, der Oper würdige Passagen in den kaum mehr als zehnminütigen Sätzen. Namentlich die affektstarken mittleren langsamen Sätze zeigen den Venezianer auf der Höhe seines Schaffens, auch was den inneren Dialog mit anderen Instrumenten und -gruppen betrifft. Ein deutlicher qualitativer Unterschied innerhalb der Konzerte lässt sich nicht feststellen.
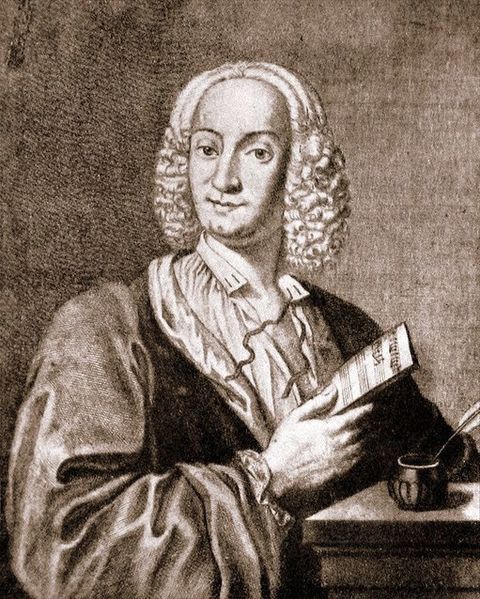
Die Rätselfrage lautet: Wem hatte Vivaldi möglicherweise die Konzerte zugeeignet? War es ein Deal, der einem Verwandten oder einem Musiker aus seinem venezianischen Umfeld zugute kommen sollte, damit dieser oder – weniger wahrscheinlich – diese von konzertanten Aufführungen profitieren konnte. Es ist schon denkbar, dass die Konzerte nur wegen einer solchen Auftragsbeschaffung zustande kamen; vielleicht sollte der Name des Fagottisten auch nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Oder war er so wenig bekannt, dass er hinter Vivaldi als dem Urheber der Konzerte zu „verschwinden“ hatte? Oder war „er“ doch eine „sie“ und genoss innerhalb der männlichen Netzwerke deshalb geringere Aufmerksamkeit?
Der ideale, da diese Konzerte in der Praxis über etliche Jahre erprobende wie auch forschende Fagottist Sergio Azzolini, spielte die vorhandenen Beispiele praktisch komplett ein, von 2012 bis 2018 ganze 33 Konzerte für das sonor und gleichzeitig anschmiegsam dröhnende Holzblasinstrument alleine, 6 in seiner Verbindung mit der Oboe, dabei unterstützt durch den Duopartner Hans Peter Westermann. Zuletzt unterstützte ihn das Orchester L’Onda Harmonica bei der Aufnahme der noch fehlenden sieben Konzerte, mit der die Serie Concerti per fagotto beim Label Naive ihren Abschluss fand. Um das Jahr 2012 hatte Azzolini das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Orchester L’Aura Soave Cremona gestartet; mithin dauerte es bis zum Abschluss der Gesamteinspielung also nur etwas mehr als sechs Jahre.

Schreibe einen Kommentar