
Sie wurde in jeglicher Weise veranlasst, sich den gesellschaftlichen Konventionen ihrer Zeit und ihrer Berliner Umgebung anzupassen, auch wenn diese häufig nicht ihren persönlichen Bedürfnissen und ihren Vorstellungen der Teilhabe entsprochen haben dürften: Fanny Mendelssohn, auch von ihrem Bruder Felix Mendelssohn-Bartholdy verkannte Komponistin und Pianistin, kämpfte mit den Mitteln einer von ihrer Kunst überzeugten Frau um ihre Emanzipation und starb allzu früh im Alter von 42 Jahren.

Dennoch konvertierte die Hamburger Jüdin, nicht ohne Zwänge von außen, zuerst von ihrem Glauben zur evangelisch-lutherischen Konfession, 24jährig heiratete sie im Jahr 1829 den preußischen Hofmaler Wilhelm Hensel und war durch den Eintritt ins Berlinische Bürgertum gezwungen, eine Doppelrolle zu spielen, als inkludierte Ehefrau und Mutter, an zweiter Stelle als bedeutende Musikerin und Musikschaffende, die aber niemals die Anerkennung fand, die ihr angesichts ihres Werks und ihrer Konzerte eigentlich zustand. Dies stellt nicht in Frage, dass sie nicht auch glückliche Zeiten erlebt hätte, etwa als produktive Schaffende, in den künstlerischen Frauenzirkeln und -freundschaften und auf einer langen Italienreise mit ihrem Mann.
Fanny Hensel schrieb außer zahlreichen Chorwerken, vielen Liedern mit Klavierbegleitung eine Kantate, zwei Oratorien, eine Ouvertüre in C-Dur für Orchester, das mittlerweile gut bekannte Klaviertrio d-Moll und etliche Sololiteratur für das Klavier, aus der ihr zwölfteiliger Zyklus Das Jahr (1841) herausragt, an dessen Edition ihr Ehemann Wilhelm maßgeblich beteiligt war und den Band mit seinen eigenen Vignetten verzierte.
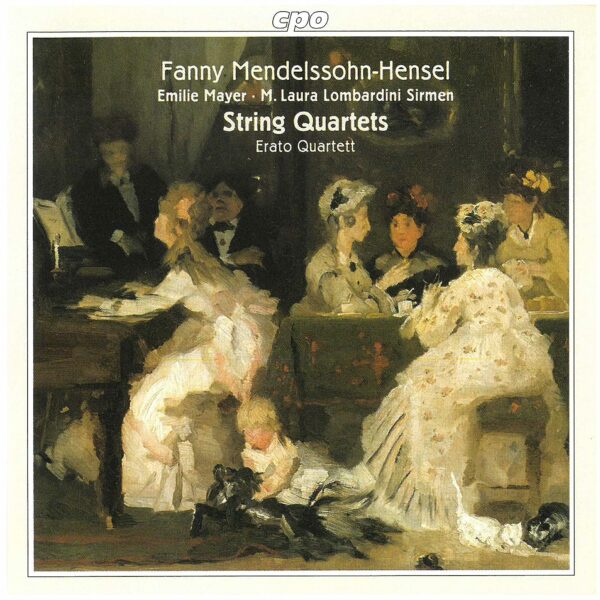
Etliche der glücklicherweise zum großen Teil noch als Autographen vorliegenden Kompositionen wurden zu ihren Lebzeiten erst gar nicht gedruckt. So widerfuhr es auch dem bemerkenswerten Streichquartett in Es-Dur, das kürzlich vom Südtiroler Selini-Quartett eingespielt wurde.
Nachdem der Bruder Felix das Quartett durchstudiert hatte, hielt er sich mit seiner Kritik an der Form des Ganzen nicht zurück, zeigte aber damit, dass er die Konventionen der Wiener Klassik nicht beschnitten sehen wollte. Es ist zu bedauern, dass seine Schwester allzu eilfertig nachgab und dazu bemerkte: „Es ist nicht sowohl die Schreibart, an der es fehlt, als ein gewisses Lebensprinzip, u. diesem Mangel zufolge sterben meine längern Sachen in ihrer Jugend an Altersschwäche, es fehlt mir die Kraft, die Gedanken gehörig festzuhalten, ihnen die nöthige Consistenz zu geben.“
Doch eben diesen Zug müsste man nach heutigen Maßstäben euphemistisch umformulieren, denn mit dem Werk unternahm Fanny Hensel eindeutig einen Vorstoß in die damals romantische Moderne hinein, indem sie den Hauptsatz der Sonatenform wegließ und stattdessen eine durchdramatisierte Abfolge von „Fantasiestücken“ bot, wobei Günter Marx zufolge das Rondothema im quicklebendig loslegenden Schlusssatz in zunehmend abgewandelter Form erscheint.
