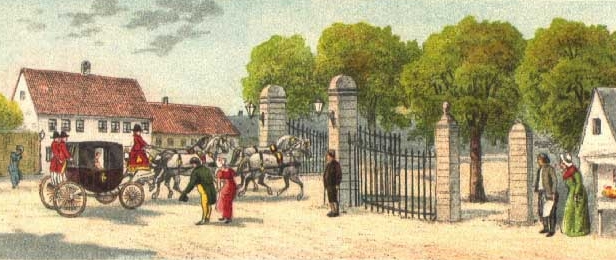setzte seinen künstlerischen Weg
nach dem Vorrücken von Napoleons Truppen
in Kopenhagen fort. (dev.molariscd.pl)
Sein zweites Klavierquartett in der Tonart A-Dur adressierte der vor den Franzosen aus Hamburg geflohene Pianist Friedrich Kuhlau, der sonst überwiegend für die Flöte komponierte, an seinen, dem Militär angehörigen und mit ihm regelrecht befreundeten Lieblingsschüler Anton Keyper als Hommage. Es geriet zu einem seiner populärsten Werke überhaupt, was ebenso an seinen melodiösen Themen und den verschachtelten Instrumentenkombinationen lag, die Neugier und Aufmerksamkeit beim zeitgenössischen Publikum weckten.
Der Wechsel zwischen den Tonarten in seinem op. 50 ist bemerkenswert, reicht vom Ausgang in A-Dur über einen langsamen Satz in F hin zu einem rhythmisch prägnanten Presto in a-Moll. Das Raffinement besonders in den kontrapunktischen Passagen und hinsichtlich der Rhythmusverschiebungen durch Hemiolen steht der Feinarbeit Beethovens in keiner Weise nach und führt in der Satzfaktur gewissermaßen dessen frühromantische „zweite Natur“ fort. Fast tiefsinnige Finesse weisen die beiden letzten Sätze Scherzo und Finale auf.
Sechs Jahre später, also im Jahr 1829, setzte Kuhlau die Reihe seiner Quartette mit dem dritten in g-Moll (op. 108) fort, das Ignaz Moscheles teilweise lobte, teils kritisch aufnahm: Es weise große Stilkunst auf, es tauchten in ihm aber „Reminiscenzen“, also Imitationen – in diesem Fall von Anfängen aus Mozarts Klavierquartetten – auf, was auf die Schwierigkeit, die Komposition technisch zu bewältigen, hinweisen sollte. Kuhlau selbst hielt das Quartett hingegen für sein am meisten elaboriertes, auch wenn es weniger innovativ war. Der Musikwissenschaftler Gorm Busk entdeckte an einigen Passagen sowohl im langsamen als auch in den schnellen Teilen eine gewisse Atemlosigkeit oder Hektik, wobei allerdings an der kontrapunktischen Technik des Meisters aus Uelzen wie auch in seiner vorhergehenden Kammermusik kein Makel zu finden ist.

Flötenwerken (ASIN: B01G4CQ3KI).
Eine nicht genug zu lobende Aufnahme mit Elisabeth Westenholz, Tutter Givskov, Lars Grunth und Asger Lund Christiansen aus dem Jahr 1996 lässt allerdings keinerlei Zweifel an der hohen und auch eleganten Kunst Kuhlaus, der sich in Kopenhagen zunächst als Klavierlehrer verdingt hatte, dann mit Røverborgen („Die Räuberburg“) und schließlich mit Elverhøj („Elfenhügel“) zum gefragten Opernkomponisten avancierte. Glücklicherweise erklingt hier auch eine frühe Sonate für Violine und Klavier in f-Moll, die den sprühenden Geist des 35jährigen Komponisten unter Beweis stellt und über eine große Varietät an Kontrapunktik, beschwörender Motiverfindung und -technik erkennen lässt.
Literatur u.a.
Jørgen Erichsen: Johann Kuhlau: ein deutscher Musiker in Kopenhagen. Eine Biographie nach zeitgenössischen Dokumenten. Aus dem Dänischen übersetzt von Marie Louise Reitberger. Hildesheim 2011.