Luftig und wolkig wirkt dem Korpusaussehen nach ein altes Cister-Instrument, dessen Bedeutung als Zupfinstrument sich ausschließlich auf die Zeit der Renaissancepolyphonie und des Früh- und Hochbarock zentriert. Aus diesem Grund dürfte das Orpheoreon oder Orpharion heute nur noch eine Angelegenheit von Experten für Kastenhalslauten sein. Einer von wenigen dieser Zunft ist aktuell Dieter Schossig, der über etliche Dezennien historische Lauteninstrumente unterschiedlichster Form und Größe (nach)gebaut hat.
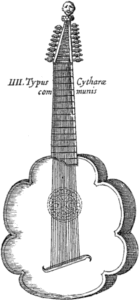

Verwandt ist das Orpheoreon mit dem Bandoer oder der Pandora, wie Praetorius im zweiten Band des Syntagma musicum schreibt, allerdings etwas kleiner „von Messings- vnd Stälenen Saitten“. Seine besondere Charakteristik liegt in den acht zweifachen aus Darm gefertigten Saitenchören, die in zwei Stimmungsvarianten vorliegen. Mit lediglich 120 cm in der Länge inklusive Hals ist das Orpheoreon kürzer als das im Bau ähnliche Penorcon, die auf Abbildungen in Manualen der Zeit oft nur schwer zu unterscheiden sind.
Hinsichtlich Spiel und Klang ist wesentlich, dass bei diesem Zupfinstrument Sattel und Steg schräg zum Hals verlaufen, weshalb die schwingende Saitenlänge vom Diskant zum Bass hin zunimmt. Nicht nur in englischen Quellen um 1600 wird das Orpheoreon alternativ zu Laute oder Pandora angegeben, neben Solowerken von Anthony Holborne sehen es John Dowlands Lieder der Sammlung The first Booke of Songs or Ayres of fowre Parts (1597) ausdrücklich zum Zweck der Begleitung vor.
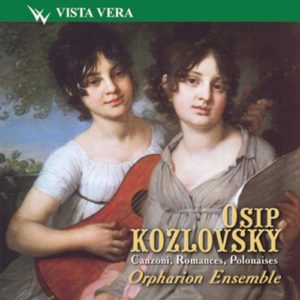
Die klanglich sehr heterogen zusammengesetzte Moskauer Kammerformation Orpharion Ensemble gar trägt das heute weitgehend unbekannte Instrument in seinem Namen; bemerkenswert ist seine Einspielung mit gänzlich renaissancefernen Werken von Ozip Kozlovsky (1757 – 1831), einem russisch-polnischen Komponisten der Vor- und Frühklassik.
Literatur u.a.
Ian Harwood, Lyle Nordstrom: Orpharion. In: Grove Music Online, 2001.
Wells, Robin Headlam: Elizabethan Mythologies: Studies in Poetry, Drama, and Music. Cambridge 1994.