Einen (Wiener) Walzer denkt man sich schmissig und in abschnittsweise wirbelnder Geschwindigkeit getanzt wie gespielt. Russische Bearbeitungen von Walzern, handelt es sich nicht gerade um jenen berühmten Walzer Nr. 2 von Dmitrij Schostakowitsch, werden dagegen oft moderat in Tempo und Affekt in Szene gesetzt.
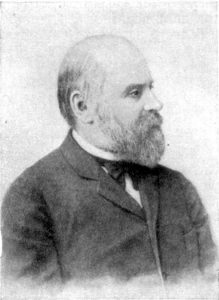
Dies betrifft auch jene im Dreiertakt stehende und von sich aus eher schwungvolle Volksliedmelodie, die heute nicht alleine auf jedem Klassiksender, sondern nahezu weiterhin an jeder Straßenecke zu hören ist: das instrumentalisierte Lied Bella ragazza dalle trecce bionde in Tschaikowskys 1880 uraufgeführtem Capriccio Italien op. 45, mal behäbig einem gewichtigen Bären gleich von einem Bein aufs andere trottend (siehe Charles Dutoits Interpretation mit dem Orchestre symphonique de Montréal von 1986), mal federleicht über dem Boden schwebend vorgetragen …
Seine Wirkung auf das Publikum im klammen Moskauer Vorwinter hat das nur knapp sechzehnminütige Orchesterwerk wohl nicht verfehlt, doch war es ebenso der Kritik ausgesetzt: César Cui, einer der Musikdiktatoren des „mächtigen Häufleins“, wollte es im Zuge des Vorwurfs der „Verwestlichung“ nicht als Kunstwerk gelten lassen, obwohl es den Zuhörern ausnehmend gut gefiel.

Abgesehen davon, dass das keinem der „Gattungsvorgabe“ entsprechenden Formschema folgende Capriccio Italien fast ausschließlich italienische Weisen zitiert, ist es in seiner Anlage zu einem großen Teil doch als russisch-romantisch zu betrachten, und dies bis hinein in die Instrumentation der Abschnitte. Seine kompositorische Originalität hat freilich Grenzen, denn bekanntlich folgte Tschaikowsky damals dem Rat von Mily Balakirew, es nach dem Schema von Michail Glinkas Nacht in Madrid anzulegen. Das genuin „abendländisch“-westliche Prinzip der Anordnung ABA im Rahmen des Ganzen wird darüber hinaus angewendet, was den Eindruck des Kritikers Cui, der auf „russischer“ Idiomatik bestand, sicherlich verstärkte.
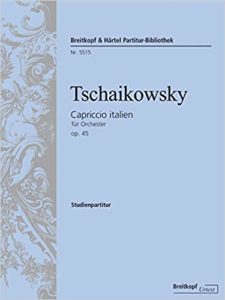
Eine auffällige Parallele zum Gebrauch orientalisch-südspanischen Rhythmus- und Melodiekolorits im Anfangs- und Mittelteil weist Rimsky-Korsakoffs Scheherazade (1888) auf. Die variative Konstruktion der Gesamtkomposition des Capriccio Italien allerdings sollte – wie geschehen – angesichts der zahlreichen Vorbilder im 19. Jahrhundert nicht als Besonderheit bezeichnet werden: Der Wechsel von asymmetrischem und geradtaktigem Periodenbau ebenso wie Phrasenverschränkung und Diminution sind kein Alleinstellungsmerkmal dieses Werks, sondern wurden von Tonsetzern vorangehender Generationen inklusive der späten Wiener Klassik gerne gebraucht. Zieht man Hector Berlioz‘ Einsatz des Englisch Horn in elegisch-sehnsuchtsvoll klagenden Passagen seines symphonischen Werks hinzu, so fragt sich, warum Tschaikowsky nicht diesem für derartige Melodien doch vor allen anderen geeigneten Instrument den Vorzug vor der Oboe (im Zusammenspiel mit der Klarinette) gab.