Von offizieller Seite wird die Entwicklung einer klassischen „Szene“ im Staat an der äußersten Nordwestkante des karibischen Meers gerne mit dem Namen von Carl Härtling in Verbindung gebracht. Nach Musikstudien in Weimar und Leipzig und mit einem Münchener Examen in der Tasche verschlug es den knapp Siebenundzwanzigjährigen bald, nämlich 1896, nach Honduras, wo er fortan als Leiter einer Militärkapelle und Musikdozent fungierte. Da auf der mittelamerikanischen Landbrücke seit längerem gleich drei Kulturen, eine indianische, eine schwarzafrikanische und eine kolonialeuropäische nebeneinander existierten, stieß er auf ein reiches folkloristisches Musikleben. Die indigene Tradition rekurriert vor allem auf Blasinstrumente wie den „Sumpffrosch“ von Yaxchilan, Zampoñas, Varianten der Andenflöte unter der Bezeichnung Quenas, auf die gezupften Charangos und verschiedene landesspezifische Trommeln.

Seitdem hat sich natürlich das Bild gewandelt, denn wie in anderen Regionen der Karibik spielt der „schwarze“ Stil des Garifuna, einem Import von St. Vincent, heute die größte Rollen neben Bands, die an der amerikanischen Pop- und Rockmusik orientiert sind. Außerdem behaupten sich weiterhin diverse Spielarten des Reggae.
Doch zurück zum klassischen Repertoire: „Carlos“ Härtling wurde in erster Linie deshalb zu einer wichtigen Identifikationsfigur für die Einwohner von Honduras, weil er 1903 nach dem Gedicht von Augusto Constancio Coello die 12 Jahre später offiziell nominierte Nationalhymne des Landes schuf.

Es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass der Dirigent mit dem deutschen Visum patriotische wie staats- und militärtreue Werke komponierte: Außer Saludo de Tegucigalpa, El Murmullo de los Pinos Hondureños – „Das Flüstern der Kiefern in Honduras“ – und Bajo la Bandera Hondureña – „Unter der honduranischen Flagge“ – entstanden so Eterna Paz, der Trauermarsch für den Präsidenten General Manuel Bonilla sowie der „Marsch für General Morazán“.
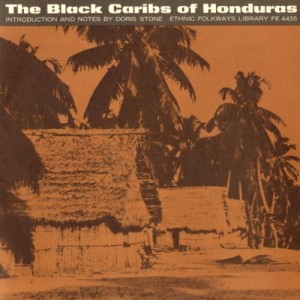
Außer Flöten- und Perkussionsinstrumenten setzte sich in der honduranischen künstlerischen Musik schon vor dem 19. Jahrhundert die ursprünglich afrikanische Marimba durch. Mit der gleichfalls an Zuspruch gewinnenden kreolischen folkloristischen Musik kamen von größeren Formationen gespielte Stücke, besonders El Candú, El Pitero oder Tirito Pinto auf, zu denen Filmdokumentationen im Internet vorliegen. Neben dem 2014 wiederbegründeten Nationalen Symphonieorchester bestehen zwei andere bedeutende Klangkörper in Nicaraguas Nachbarstaat: das Philharmonische Orchester von Honduras und das Kammerorchester San Pedro Sula. Der Basssänger Enrique Castro stammt ebenso von Honduras wie die Bratschistin Gina Ocampo oder der Oboist Roberto Varela und die Flötistin Laura Sierra. Weithin reicht auch der Ruf des Opernhauses Teatro Nacional Manuel Bonilla.
Schreibe einen Kommentar