Die Blechblasbewegung ist ein Sonderphänomen der europäischen Besiedlung Neuseelands seit dem 19. Jahrhundert. Sie hat ihre Wurzeln in den Militärkapellen der britischen Truppen, die hier stationiert waren. Mittlerweile nehmen aber viele Komponisten mit klassischer „weißer“ Ausbildung Bezug auf die Musik der Maori, die den anderen und ursprünglichen Teil der neuseeländischen Gesellschaft ausmachen, oder lassen sich wenigstens von dieser inspirieren.

Schnelle Sprechgesänge ohne metrische Vorgaben und Tänze aus ursprünglich kriegerischem Kontext bestimmen die Auftritte der Einheimischen, die einige Zeit vor den schottischen Zuwanderern „Aotearoa“ bewohnten. In vorkolonialer Zeit zeichnete sich ihr Liedrepertoire durch mikrotonale Intervalle aus und durch melodische Linien um einen zentralen Ton, die vielfach hintereinander wiederholt wurden. Beim Auftritt in Chorformation nutzte man Oktavverdopplung. Die Gesänge der Maori wurden von Blasinstrumenten aus Knochen, Elfenbein, Meeresschnecken und Holz unter dem Sammelbegriff taonga puoro begleitet sowie durch Idiophone. Den Instrumenten wird magische Wirkung zugeschrieben, sie werden aber auch ganz funktional als Signalgeber benutzt: So kündigt zum Beispiel die Trompetenschnecke Besuch an.

Von Seiten einer deutlich später Fuß fassenden „weißen Musik“ war es zunächst Alfred Hill, der die europäische romantische Musik auf dem entlegenen Kleinkontinent etablierte. Und doch gilt erst Douglas Lilburn (1915 – 2001) vor allem mit seiner symphonischen programmatischen Musik als der eigentliche Begründer einer eigenständigen neuseeländischen Musiksprache. In seiner eigenen Generation erwuchs ihm auf dem Gebiet klassischen Komponierens kaum Konkurrenz. Ihm folgte die 1941 geborene Gillian Whitehead, die zunächst in Australien bei Peter Sculthorpe studierte. Nach weiteren Jahren in Großbritannien, Portugal und Italien ließ sie sich in New South Wales nieder. Am populärsten wurde ihre Oper Outrageous Fortune, doch schuf sie bislang eine große Anzahl von Kammer- und Orchesterwerken sowie solistische und Chormusik. Eine Auswahl ihrer Kammermusik liegt bei Waiteata Press in einer CD-Einspielung vor.
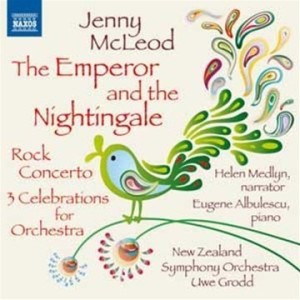
Jenny McLeod, die dem gleichen Jahrgang angehört, machte Karriere als Professorin an der Victoria University von Wellington; sie entwickelte die Tone-Clock-Technik, die ein paralleles Tonleiter- und Harmoniesystem auf chromatischer Basis vorsieht.
Eine Generation später festigte John Psathas, Jahrgang 1966 und Sohn griechischer Einwanderer, den Ruf Neuseelands als „Außenposten“ genuin europäischer Kunstmusik, wobei das Schlagwerk eine prominenten Platz einnimmt. Mit Omnifenix, seinem Konzert für Saxophon, Perkussion und Orchester schaffte der Neuseeländer mit zweitem Standbein in Athen bei einem Freilfuftkonzert im Jahr 2000 in Bologna auch einen europäischen Durchbruch.
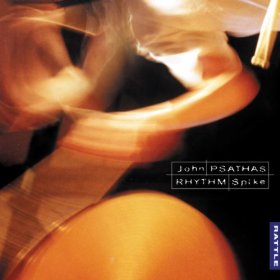
Große Beachtung fand auch Psathas‘ 2002 mit Evelyn Glennie aufgeführtes Klavier- und Schlagzeugkonzert View from Olympia. Anlässlich der Olympischen Spiele in Athen 2004 erklangen zahlreiche von ihm hierfür geschriebene Fanfaren und ein Werk für die Abschlusszeremonie. 2012 sorgte Planet Damnation in der Besetzung mit Timpani und Orchester für Aufmerksamkeit. Die Three Island Songs von 1996 stellen in gewisser Weise einen Nachhall auf Douglas Lilburns A Song of Islands und eine Hommage an dessen Verdienste um die identitäre neuseeländische Kunstmusikszene dar.
Schreibe einen Kommentar