Ihre Blütezeit feierte die mit einem Auftakt versehene geschwinde Courante in Frankreich schon ab 1600 und rückte dort bald zum wichtigsten Tanz überhaupt auf. Dies zumindest erwähnt Marin Mersennes auch musikpraktisch angelegtes Handbuch Harmonie universelle von 1636. Die ursprüngliche, etwas rumpelige Derbheit verlor sie in ihren leichtfüßigeren Versionen am Hof Ludwig XIV. rasch. Nach der Ouvertüre steht sie in der Suite gleich an zweiter Stelle, wo sie den alten Spring- oder Nachtanz ersetzt. Allerdings wurden die polyphon angelegten und ihrem Tanzcharakter nach elegant dahinfließenden Sätze vorwiegend nicht für eine „Tanzkapelle“ oder das Orchester komponiert, sondern für Tasteninstrumente. Als populäre Beispiele gelten heute weithin Cembalosuiten von Dieterich Buxtehude und die Stücke von Thomas Simpson oder William Brade.
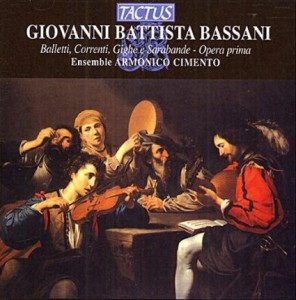
Wer auch immer hier zur Bereicherung des Repertoires und zur Stilisierung beigetragen hat, dass es sich um einen genuin französischen Tanz handelt, dem von Thoinot Arbeau 1588 pantomimische Elemente zugeschrieben wurden. Erst seit Mitte des 16. Jahrhunderts ist die Form überhaupt belegt, häufig in Verbindung mit wohl älteren Tänzen, bei Claude Gervaise etwa als Bransle courant. Ihre Spätform im Frankreich des 17. Jahrhunderts ist durch ein eher gemächliches Tempo sowie häufigen Wechsel zwischen einem 3/2- und einem 3/4-Takt gekennzeichnet. In Italien pflegte man dagegen die Corrente in schnellem Metrum, gleichmäßig durchkomponiert im belebten 3/4- oder 3/8-Takt. Exemplarisch steht dafür Giovanni Battista Bassanis Sammlung Balletti, correnti, gighe, e sarabande für eine Besetzung mit Violine, Bratsche und Cembalo aus dem Jahr 1677, daneben Corellis Kammersonaten von 1685 und 1694 sowie noch seine späteren Concerti grossi.
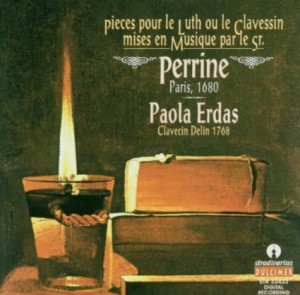
Mit kleiner Verzögerung fand die Courante Eingang in die englische Musik – nämlich mit dem berühmten Fitzwilliam Virginal Book – und in deutschsprachigen Gebieten. Hier taucht sie bei Valerius Otto auf, in Johann Hermann Scheins Banchetto musicale und in extensivem Ausmaß in Michael Praetorius‘ Terpsichore. Johann Jakob Froberger und J.S. Bach machten in verschiedenen Instrumentalwerken Gebrauch von der Form. Bassanis Werk brachte übrigens das Ensemble Armonico Cimento beim italienischen Label Tactus auf klingende Scheiben, Denis und Ennemond Gaultiers Sammlung für die Laute oder das Cembalo von 1680 mit insgesamt 10 Couranten-Nummern wurden von Paola und Paolo Erdas bei Stradivarius eingespielt.
Schreibe einen Kommentar