Schlagwort: Frédéric Chopin
-
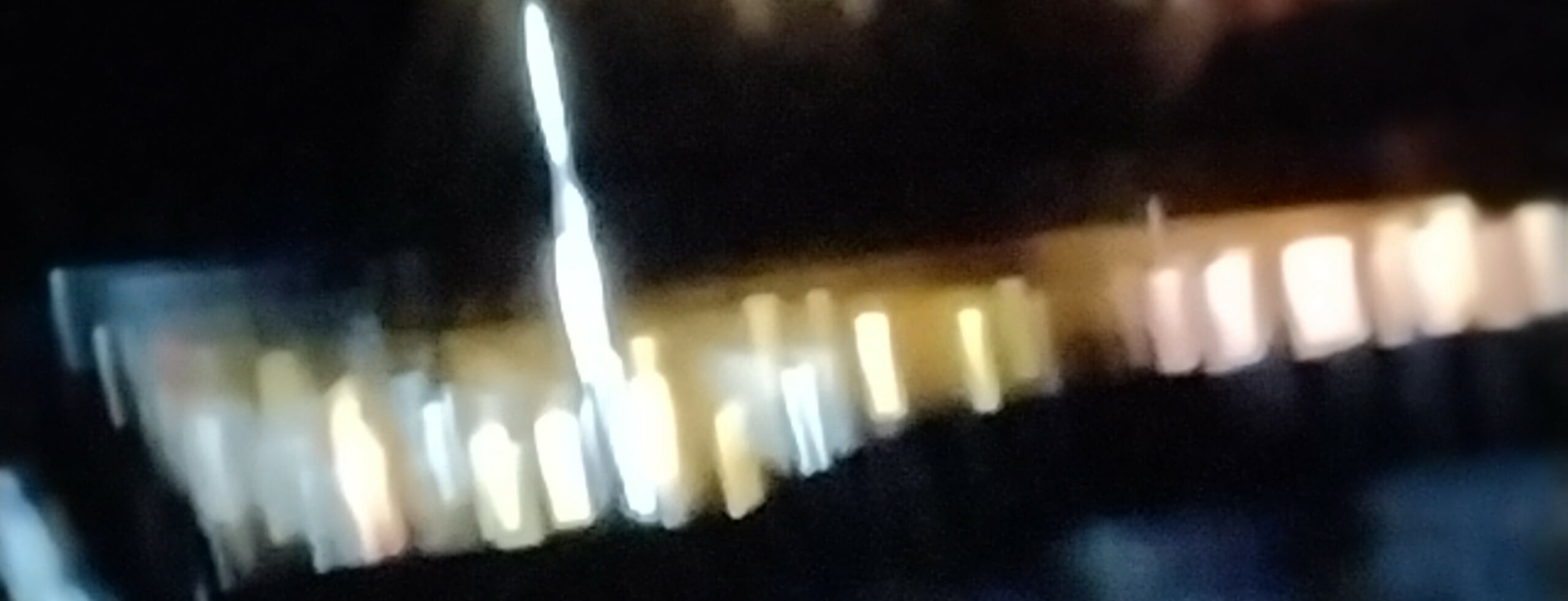
Einhören in die Münchner Klaviertage
Auftakt nach den mit passablem Frühjahrswetter gesegneten Pfingstfeiertagen: In der Reaktorhalle der Hochschule für Musik München stellten sich am 21. Mai sieben Klavierstudenten aus fünf verschiedenen Klassen einem rangfüllenden Publikum vor, und zwar mit einem angemessen vielfältigen Chopin-Programm, zu dem gewissermaßen die einzige Mozart-Sonate des Abends, nämlich diejenige in B-Dur (KV 570) ein entspanntes Gegengewicht…
-

Raritäten und eine Aktualisierung
Bis in die Sattelzeit, die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts hinein war es üblich, dass Orchester vom Cembalo aus dirigiert wurden. Etwas ungewöhnlich scheint es daher, wenn heute ein seit beinahe vierzig Jahren etablierter Dirigent vom modernen Klavier aus dirigiert, allerdings keineswegs den Continuo-Part spielt, sondern die solistische Rolle innehat: So verhält es sich bei…
-
Aus dem schottischen Hochland
Von schottischen Höhen in die Tanzsäle der Biedermeierzeit: Die vermutlich lange Vorgeschichte zur Entstehung der Écossaise umfasst den langen Zeitraum mittelalterlicher gälischer Popularmusik, in dem Gesang und Tanz zu den Klängen des Dudelsacks Hand in Hand gingen. Ursprünglich handelte es sich um einen eher gemächlichen Schreittanz zahlreicher Teilnehmender in Kolonnenanordnung.
-
Gestohlene Zeitwerte
Zeit wird abgezogen und (nicht immer wieder) dazugegeben: Als Möglichkeit im mehrstimmigen Musizieren breitete sich das Tempo rubato, abgeleitet von „rubamento“ wohl schon vor seiner theoretischen Beschreibung durch Ludovico Zacconi im Jahr 1592 aus; Temposchwankungen dieser Art innerhalb eines Stücks wurden als Spielvorgabe wohl seit Ende des 16. Jahrhunderts gebunden vorgeschrieben.
-
Tempo rubato – die Freiheit des Spielers
Die genaue Einhaltung des Metrums, namentlich in Gesangspartien, war kaum jemals geltende Konvention der musikalischen Praxis, abgesehen vielleicht von mancher strengen monodischen Liturgie der Kirche. Ganz im Gegenteil: Die freie Nutzung einer vorgegebenen Melodie oder eines Notentexts als partikulare und weitergehende Improvisation (hinsichtlich der Zeitwerte) war in allen Kulturen die Norm, zumal in folkloristischen Zusammenhängen, seien es Tänze…