
Theodor Storms Sohn Karl war Musiklehrer in Varel, er selbst spielte Klavier, leitete über viele Jahre von ihm gegründete Chöre und komponierte zudem, wenn auch akzidentiell. In welcher Weise auch immer, es ist festzuhalten, dass im Haus des Amtsrichters Storm die Musik prominent präsent war. Umso erstaunlicher ist es, dass sie gerade in der Künstlernovelle Ein stiller Musikant (1874/75), die ein indirektes Porträt seines eigenen Sohns Karl als „Zerrbild“ darstellen könnte, eine untergeordnete Rolle gegenüber der psychologisch exponierten unglücklichen Liebe des in den Mittelpunkt gestellten Malers Ede Brunken spielt.
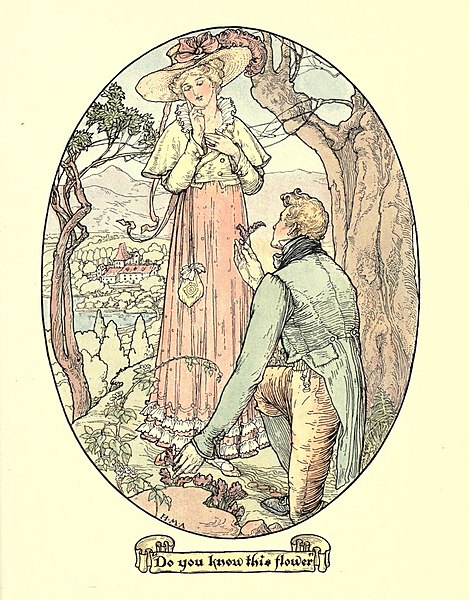
Welchen Niederschlag fand die Musik aber als Gegenstand und Motiv in seinem novellistischen Werk, nachdem seine Gedichte, insbesondere diejenigen mit romantischem Sujet, ohnehin ganz musikalisch „erdacht“ scheinen? Reinhard in Immensee (1849) ist leidenschaftlicher Liedersammler. Und so ist es auch kein Zufall, wenn er einer Zither spielenden Zigeunerin die Kuchen schenkt, die ihm seine Mutter geschickt hatte. Die Verschränkung mit der Handlung der gesamten Binnengeschichte dieser Novelle ergibt sich durch das gesungene Lied Meine Mutter hat’s gewollt, das sein Urheber, der seine Eigenschöpfung kaschiert, selbst vorträgt und mit dem er alle im Gesellschaftszimmer anwesenden Personen indirekt anspricht, darin einen Vorwurf an Elisabeths Mutter verschlüsselnd, die sich eine bessere Partie für ihre Tochter gewünscht hatte, denn der zweite Kandidat Erich ist Eigentümer einer Spirituosenfabrik geworden. In mancher Weise erscheint dies verständlich, wenn Frauen auf den Arbeitsmarkt nur schwer Zugang fanden und meist ihr ganzes Leben hindurch ökonomisch vom Ehemann abhängig waren. Erich schenkt vorhergehend Elisabeth einen zwitschernden Kanarienvogel, der ihm bei seiner Liebeswerbung um sie als „Lockvogel“ dient, nachdem Reinhards Hänfling, den er ihr als verliebter Jugendlicher gegeben hatte, bei ihr verstorben ist.

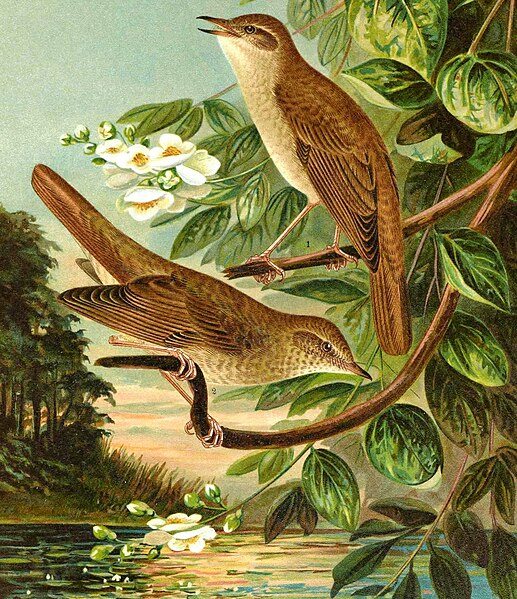
Ein anderer toter Singvogel ist in Ein Fest auf Haderslevhuus (1885) das Rotkehlchen, das nach Heilwigs Pesttod verhungert. Dagmars und Rolfs erste Umarmung in derselben Novelle vom Schlagen der Nachtigall begleitet, deren Gesang die Worte der Liebenden ersetzt. Die gemeinsame Nacht von Katharina und Johannes in Aquis submersus (1975/76) wird gleichermaßen durch den Gesang einer Nachtigall vorausgedeutet. Dasselbe gilt für die Prolepse der Liebesbegegnung zwischen Lore und Philipp in Auf der Universität (1862) durch eine schlagende Drossel im Schlossgarten. In der deutlich früher entstandenen Novelle Immensee hingegen könnte die singende Nachtigall zunächst ein Element des Ausdrucks romantischer Naturstimmung sein; es könnte aber auch auf die sich anbahnende Beziehung zwischen Elisabeth und Reinhard verweisen ebenso wie die Buchfinken in Ein grünes Blatt (1850/54) auf die Verbindung Gabriels zu Regine. Ein Lied, das Gabriel singt, dient der Überbrückung einer Verlegenheitssituation, da das Verhältnis von Regine und ihm nicht geklärt ist. Der Vogelsangsee in „Es waren zwei Königskinder“ (1884) steht mit seinem Namen diametral zu Marx‘ Tod, ist aber komplementär zu der Liebeskonstellation in dieser Novelle. Im Kontrast hierzu versinnbildlicht der singende Dompfaff in Bötjer Basch (1885/86) in dessen Erinnerung die für ihn glückliche Zeit, als sein Sohn noch bei ihm lebte. Singvögel sind seit der mittelalterlichen Dichtung ein beliebtes und konventionelles Motiv; insofern schließt sich Storm damit einer fast zum Klischee geronnenen Konvention an.
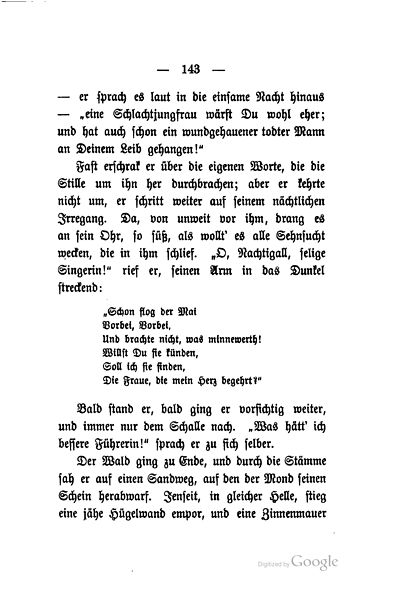

Die Gitarre spielende Kätti in der Novelle Zur „Wald- und Wasserfreude“ schließt sich, ihrer wilden persönlichen Natur entsprechend, einer Gruppe umherschweifender Musikanten an, und es ist kein Zufall, dass ihr der Geige spielende Sträkelstrakel folgt. Rolf Lembecks Ehebruch in Ein Fest auf Haderslevhuus wird durch eine diesem ähnliche Musikerfigur, den harlekinhaften Gaspard, in einem Lied vorweggenommen.
Mehr noch als die Musik sind es Naturgeräusche jeglicher Art, einschließlich des häufig verwendeten Vogelgesangs, die von Storm in symbolischer und proleptischer Absicht gebraucht werden. Die Bedeutung von Kunstmusik für den Dichter selbst findet in seinem Prosaschaffen bemerkenswerterweise keinen großen Widerhall, wiewohl Haydn und Mozart namentlich als Favoriten des Malers in Ein stiller Musikant aufgeführt werden.
Literatur u.a.
Hanns-Peter Mederer: Naturobjekte als Substitute für sprachliche Kommunikation in den Novellen Theodor Storms. Magisterarbeit. Hamburg 1989 (SUB Hamburg Signatur: 89 T 1488: 1)
Heiner Mückenberger: Theodor Storm und sein Leben in der Musik. Frankfurt a.M. u.a. 2013.
Wolfgang Stockmeier: Die Musik in den Novellen Theodor Storms. In: Musik im Unterricht 55. 1964. S. 39-42.
