Bereits Anfang Februar dieses Jahres rückte er mit der Uraufführung seines Orchesterwerks Von Ewigkeit zu Ewigkeit ins Licht der Weimarer Öffentlichkeit: Der 1987 in Sydney geborene und aufgewachsene Alex Vaughan ist evangelischer Christ und nimmt gerne zentrale Aussagen der Bibel zum Anlass auch für rein instrumentale Stücke. Mut zu Neuem bewies am 23. und 24. Mai ebenso das Philharmonische Orchester Erfurt, indem es das in Auftrag gegebene Werk Ruach auf Basis des hebräischen Wortes für „Atem“ (gemeint ist der Geist Gottes) des Australiers uraufführte. Vaughan war selbst anwesend und konnte sich davon überzeugen, welche Klänge die Musikerinnen und Musiker am Theater Erfurt aus seiner Partitur hervorzauberten.
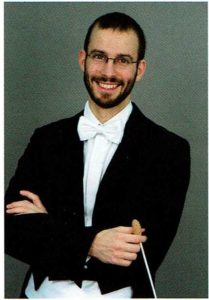
Fast gleichaltrig mit dem Komponisten selbst verlegte sich der Dirigent des Abends, Felix Bender, der derzeit in Chemnitz hauptamtlich und an der Oper Leipzig engagiert ist, auf die Herausarbeitung der Details des nicht eben einfach zu realisierenden einsätzigen Stücks. Denn im ersten Teil von Ruach scheinen die resonierenden Klangpassagen, die mit Instrumentengeräuschen – insbesondere von den Violinen und dem Perkussionsapparat hervorgebracht – wechseln und sich mit diesen kaum berühren, fast unorganisiert: Weder ein eindeutiges Metrum noch ein klares Tonspektrum sind festgelegt.
Der zweite Teil, nicht getrennt vom ersten, organisiert das scheinbar chaotisch entworfene Ausgangsmaterial vertikal zu akkordischen Harmonien und verleiht ihm verschiedene, nun aber identifizierbare Rhythmen. Die Komposition kulminiert in einer hochdynamischen und komplex durchwirkten Apotheose, in der von Gottes Anwesenheit das wie ein Laut gewordener Lufthauch tönende Schwirren im Schlagwerk kündet. Der Klang des Schwirrholzes ist einem Australier natürlich aus der Aborigines-Kultur vertraut – wenn es hier nicht sogar die Idee inspirierte. Damit kann der Start dieses 10. Sinfoniekonzerts der Saison durchaus als der interessanteste und markanteste Teil genannt werden. Alex Vaughan, seines Zeichens in Sydney und Weimar studierter Jazzposaunist und Komponist, hat 2018 den Thüringer Kompositionspreis gewonnen und ist auch publizistisch, etwa mit einem 150 Jazz-Kanons umfassenden Projekt hervorgetreten.

Mit einem deutlich kleineren instrumentalen Apparat kommt das 1917 beendete 1. Violinkonzert D-Dur op. 19 von Sergej Prokofjew aus, das noch nicht zeigt, wie weitgehend der russische Komponist das gesamte Spektrum der Tonalität ausschöpfen konnte. Lara Boschkor, der (kaum) zwanzigjährigen Solistin des Abends, gelang eine ausdrucksvolle Darstellung der reich untersetzt mit Diatonik und Chromatik in die Moderne verweisenden Läufe und Spieltechniken, bei denen Leidenschaft, wie sie oft Aufführungen beispielsweise von Tschaikowskys Violinkonzert mit sich bringt, der Demonstration vielfältiger Variation eher untergeordnet bleibt.

Ganz liedhaft, jedenfalls von einer einzigen ausgesponnenen Melodie getragen wirkt das Konzert heute wie aus einem Guss, dabei beschäftigte es seinen Urheber mit Unterbrechung infolge der Arbeit an einer Oper über einen längeren Zeitraum; in Angriff genommen wurde es bereits 1915. Bemerkenswert seit seiner ersten Aufführung bleibt bis heute, wie gut sich der Pianist Prokofjew in die Idiomatik und Technik der solistischen Violine hineinzuversetzen vermochte.
Nicht alleine Mut zu Neuem, sondern auch zu (relativ) Ungewohntem zeigte das Theater Erfurt nach der Pause mit Alfredo Casellas Sinfonie Nr. 1 in h-Moll. Casella gilt, nahezu parallel zu Arnold Schönberg, als einer der frühen Verfechter von Atonalität, die er als Professor an der römischen Cäcilien-Akademie etablierte, bevor er sich später dem Neoklassizismus zuwandte. Der Sinfonie, die er noch nicht dreiundzwanzigjährig schrieb, ist dieser Fortgang noch nicht anzumerken, doch ist eine Interpolation verschiedener Stilrichtungen schon festzustellen, die dem Werk den Ruf einbrachte, ein Treffen von Borodin mit Richard Strauss in Szene gesetzt zu haben.

In den drei Sätzen, von denen den ersten und dritten zwei wechselnde Tempoangaben charakterisieren, entfesselte Felix Bender das Philharmonische Orchester Erfurt, ganz gemäß den sprudelnden Einfällen des Tonsetzers, zu dynamisch-spannungsvollen Glanzpartien sowohl in den einzelnen Klangkörpergruppen, seien es die Celli mit den Kontrabässen oder die Trompeten- und Posaunensektion, als auch im Tutti.
Spielplan des Theaters Erfurt