Symphonische Dichtungen auf der Basis tschechischer Sagen, einige Stücke Kammermusik und die Symphonie Nr. 9 „Aus der Neuen Welt“: Dort, wo es um vorwiegend außermusikalische Programme oder aus folkloristischer Gebrauchsmusik Entstandenes wie die Slawischen Tänze und seine Böhmische Suite ging, wurde Antonín Dvořák konkret und vertiefte sich, auch um lyrische Stimmungen zu erzeugen, ins Detail.

Demgegenüber mögen vielen Zuhörerinnen und Zuhörernn seiner Konzerte die nationalromantisch aufgeladenen, aber nicht von einem expliziten „Programm“ geleiteten orchestralen Werke – man denke an die Symphonien Nr. 5 bis 8 – in ihrem primrepetitionsdominierten, mittels Blechbläsern und Schlagwerk auf Fortissimo-Wirkungen setzenden Gestus des Öfteren ein wenig martialisch und vordergründig erscheinen.

Dabei konnte man gestern auf dem Münchner Odeonsplatz im Anschluss an Auftritte von Diana Damrau miterleben, welchen Instrumentalfarben der Komponist vorzugsweise seine Aufmerksamkeit schenkte: Neben den Waldhörnern, die auch sonst in seiner „programmatischen“ Musik eine wichtige Rolle spielen, stellte besonders das Englisch Horn mit seinem sanften bezaubernden Ton vor allem im 2. und 3. Satz der 9. Symphonie offensichtlich die passende Alternative im traditionellen europäischen Orchester für den klagenden „Liebeston“ indianischer Flöten dar, obwohl nicht bekannt ist, dass er ihre Weisen auf seiner Nordamerikareise kennengelernt hätte.
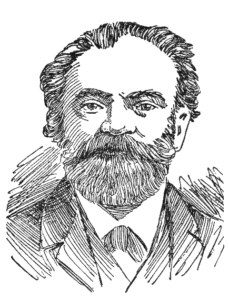
Dvořák zitierte keine der bei den Indianern erlauschten Melodien direkt, sondern ließ sich im Akt des mehr oder weniger unmittelbaren Erinnerns von ihrem emotionalen Stimmungsgehalt treiben. Dasselbe gilt für die „schwarze“ und Anfang der 1890er Jahre noch keineswegs im amerikanischen Konzertleben etablierte Musik, die in die 9. Symphonie einfloss. Cristian Măcelarus Leitung des BR-Symphonieorchesters fiel moderat schwungvoll aus, in die elegisch angesetzten Passagen des Englisch Horn floss auch ein warmer, heiterer Ton mit ein, der das triumphale Dur-Finale im Sinne einer durchweg optimistischen Sicht von den und auf die Vereinigten Staaten gewissermaßen vorwegnahm. An vielen Stellen der aus variierenden Themenkombinationen aufgebauten Sätze bricht sich die für Dvořák so charakteristische Verwendung tschechischer, mährischer und slowakischer Tänze Bahn, die sehr direkte Inspiration durch amerikanische Lebenswelten, mit der er konfrontiert wurde, vermischt sich hier jedoch unlösbar mit slawischer Folklore.