Mit der Uraufführung von Immanuel Mezgers Konzert für Violoncello und Orchester hat das Münchener Studierendenorchester Accento jetzt sein Repertoire mit einem großen Vorwärtssprung erweitert: Denn der Komponist veränderte und passte seine nicht zuletzt von Streicherpassagen in Smetanas symphonischem Zyklus Má Vlast beeinflussten und – wie er selbst sagt – eher konstruktivistischen Ideen dem Klangapparat der Musiker an. Dabei handelte es sich um einen längeren Prozess, aus dem das fertige und letztlich in großer Teamarbeit modifizierte Werk am Abend des 1. Februars 2025 im Kulturhaus des Münchener Stadtteils Milbertshofen hervorging. Heute, am 2. Februar war das Orchester mit demselben Programm, zu dem als „Appetizer“ auch die Ouvertüre zu Verdis Oper Nabucco gehört, noch im HP8-Saal des Münchner Gasteig präsent.
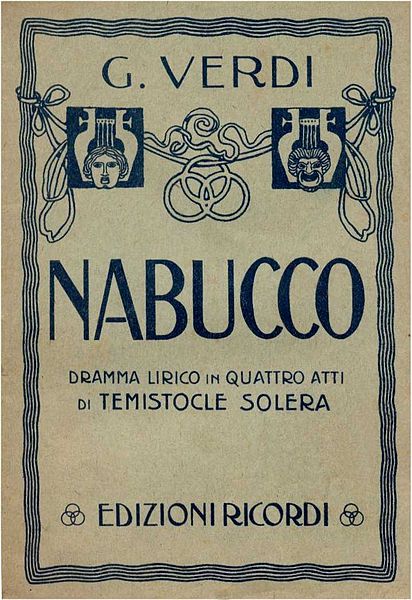

Da es sich um ein Auftragswerk des Orchesters, basierend auf einer gemeinsamen Vereinbarung mit seinem Leiter und Dirigenten, dem Norweger Torbjørn H. Arnesen, handelte, musste die Inspiration erst gefunden werden. Diese ergab sich, einfach gesagt, aus dem Anfangen, aus einem im Grunde programmatisch unabhängigen Entwurf. Und dann ging Immanuel Mezger daran, das Konzert in seinen einzelnen Teilen akribisch mit dem Orchester zusammen auszuarbeiten: Was war möglich, was musste anders gemacht werden? Die einigermaßen zeitaufwendige Kooperation resultierte in einem einsätzigen Concerto, das dem Violoncello, vom Komponisten selbst gespielt, dessen wiederholte Reminiszenzen in den Streichern an die Programmatik der Flussbewegung der Moldau Smetanas die Rahmenteile für ein selbständiges Mittelstück bildeten. Auf das Muster des Ritornells (nach dem traditionellen Muster A-B-A) folgen zwei größtenteils autonome Teile (C, D).
In seiner Vorrede wies Mezger dem Cello den eigentlich tonalen Part zu, dem Orchester die a- und polytonale Rolle. Tatsächlich referiert das Cello denn auch die anfänglichen Gedanken zum Konzert und spinnt sie solistisch unabhängig vom Orchester fort. Dabei bleibt der Charakter des Widerparts durch die Führung der Stimmen erhalten, was dem ganzen Werk auch eine dialogische Struktur verleiht. Klangfarblich originell fällt jedenfalls auch der Einsatz eher selten gebrauchter Perkussionsinstrumente aus, die eine schleifende und ratschende Klangqualität hinzufügen. Die langsamen dynamischen Steigerungen innerhalb der Konzertteile wurden vom Klangapparat des Orchesters sehr stimmig ausgeführt. Besonderen Beifall am Ende verdienten (nicht alleine) die stimmstarken Musikerinnen und Musiker an der ersten Klarinette, der Oboe, der Traversflöte und die voluminös tönenden Posaunisten und Trompeter.


Den dritten Teil des Konzertabends nach einer längeren Pause bildete schließlich Felix Mendelssohn-Bartholdys 3., „Schottische“ Symphonie, mit denen der Komponist in freier Behandlung auf die frühneuzeitliche Geschichte der nordbritischen Regionen und ihrer herben, winddurchtosten Landschaften einschließlich der Besonderheiten der Küste („Fingals Höhle“) abhob. Alle vier Sätze sind einem großen Publikum bekannt, sorgen dank der melodischen, von der Musik Nordenglands inspirierten Originalität trotz ihrer klassischen Anlage dauerhaft für Zuspruch und Applaus, so auch an diesem Münchner Samstagabend.
Dirigent Arnesen, ausgebildet in diesem Fach durch Meisterkurse bei verschiedenen, weithin bekannten Pultgrößen wie Gwyn Pitchard, Frédéric Durieux, Bjarte Engeset, Douglas Bostock, Noriko Nakamura und Mark Heron, nahm seine Aufgabe mit hoher Präzision, Spannung und Gewandtheit wahr; wie er diese bewältigte, mag manchen an routiniertere, zwanzig Jahre ältere Pultmeisterinnen und -meister erinnert haben. Von Immanuel Mezgers Handwerk versteht auch Torbjørn Arnesen eine Menge; seine kompositorischen Fertigkeiten hatte er bereits an der Musikhochschule München bei Moritz Eggert und durch das Studium bei den Bergener Professoren Dániel Peter Brío, Ruben Sverre Gjertsen und Sigurd Fisher Olsen erworben.

Dem Spendenaufruf des Moderators für das Orchester schlossen sich viele der Konzertbesucher an, damit die Entwicklung des Orchesters mit seinen vielen talentierten Musikern, das keine Einnahmen über Karten erzielen wollte, fortschreiten kann. Hinzugefügt sei, dass der Saal einschließlich der Empore überbelegt war, so groß war gerade auch das Interesse der studentischen Gäste an Orchester und Programm.
