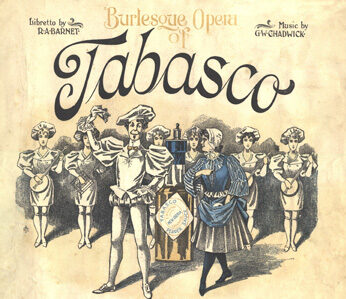Um sie von der musikalischen Humoreske zu unterscheiden, lässt sich die lose Form der Burleske so weit eingrenzen, dass es sich meist um ein flottes Instrumentalstück heiterer, scherzender oder komischer Machart handelt. Einige wurden für Tasteninstrumente, vor allem für das Klavier komponiert: Erstes prominentes Beispiel ist der fünfte Satz Burlesca aus J.S. Bachs Partita III in a-Moll. Fast die gleiche Bezeichnung trägt Schumanns Stück Nr. 12 in seinen Albumblättern, op. 124 und Bartóks Burlesques op. 8c.

Die ursprüngliche italienische Wort burla meint nichts anderes als (spöttischen) Spaß und steht literarisch sowohl der Theaterposse als auch der schwankhaften „derben“ Komödie nahe, der Groteske, der Farce und dem komischen Roman. In der Musik kam sie erst um 1700 auf und bezeichnete einzelne Sätze oder Kompositionen, hervorgegangen aus dem übermütigen Spaß dem Volksstück nahestehender Possen. Programmatisch so lokalisiert diente sie dem solistischen Klavier oder dessen Vorgängern mehr im Sinne eines Charakterstücks, während ihre weitere instrumentale Verwendung verschiedene Besetzungen aufweist.

Dazu zählen die Sinfonia Burlesca aus der Hand Leopold Mozarts, der 3. Satz Rondo-Burleske aus der 9. Sinfonie Gustav Mahlers, der auch Groteske benannt werden könnte, der 4. Satz aus dem Konzert für Violine und Orchester von Dmitri Schostakowitsch, die Burleske für Klavier und Orchester von Richard Strauss oder Petruschka, jene „Burleske in vier Bildern“ für Orchester von Igor Strawinsky, die Sinfonischen Burlesken Georg Trexlers nach Gemälden von Pieter Brueghel und die bereits der Neuen Musik im 20. Jahrhundert zuzurechnenden Burleske für Bläserquintett von Bertold Hummel. Der Begriff des Burlesken bleibt in der Überzahl dieser Kompositionen relativ unspezifisch und dient mehr dem Experimentieren mit drastischen musikalischen Mitteln als einem dramaturgisch homogenen Programm, ist in seiner gestalterischen Freiheit jedenfalls von Zwischenaktmusiken der Komödie weit entfernt.