Allzu häufig beschäftigte sich die Popularmusikforschung als Grenzgebiet zwischen Musikwissenschaft und (Europäischer) Ethnologie hierzulande noch nicht systematisch mit den Erscheinungsformen von Reggae und Dancehall. Dieses Verdienst ist nun Benjamin Burkharts Dissertation, die beim Waxmann Verlag erschien, zuzuschreiben.
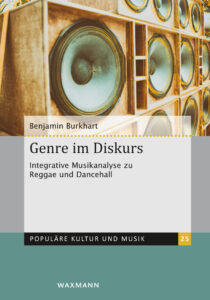
Der musikalischen Analyse sind hier einschließlich einer wohlbegründeten Auswahl von Musikbeispielen mehr als 75 Seiten gewidmet, wobei ein besonderes Augenmerk der Feinanalyse bestimmter Ausprägungen geschenkt wird, einschließlich einer fundierten Methodologie. Burkhart konzentriert sich auf den Parameter Riddims und deren Strukturen, auf den vokalen Ausdruck des jeweiligen Phänomens, Reggae-Gesang und Dancehall-Deejaying, und auf Klangtexturen. Ebenso wie das Klanggeschehen werden auch die Bewertungskriterien empirisch untersucht.
Ebenfalls aus dem Hause Waxmann kommt eine im übrigen längst fällige Studie über die Rezeption des historischen Broadway Sounds in Musicals des späten 20. Jahrhunderts durch Agnieszka Zagodzon (ISBN 978-3-8309-3934-4 Reihe Populare Musik und Kultur, Band 23). Die Autorin beschreibt die Entwicklungsgeschichte unter Einbeziehung des Einflusses von Jazz und technischen Innovationen auf der Bühne wie etwa dem Mikrofon. Im Zentrum stehen dann die Formen der Verarbeitung, Motivation und Ziele der (teils heute noch aktiven) Musical-KomponistInnen, von denen an dieser Stelle nicht zu viel verraten werden soll.
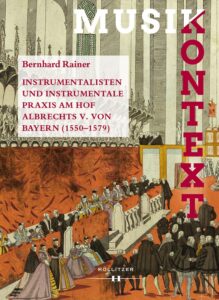
Ein zentrales Element höfischer Musik im Mitteleuropa der Renaissance sind die Instrumente als solche. Anhand einer eingehenden Untersuchung zur Musikkultur an der Hauptresidenz Herzog Albrechts V. von Bayern (1550 – 1579) geht Bernhard Rainer zunächst den archivalisch gut belegten Beständen am Münchner Hof dieser Epoche nach und bezieht auch die durch Quellen erschließbaren Instrumentalisten ein. Den Schwerpunkt des Buches bildet allerdings die Synthese, nämlich die musikalische Praxis selbst. Der Band erscheint demnächst in der Reihe Musikkontext (Nr. 16) beim österreichischen Hollitzer Verlag.
Das Paradigma Raum beherrscht schon seit vielen Jahren, insbesondere zwischen 2007 und 2017, die wissenschaftlichen Diskurse in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Studiengebieten, auch wenn es zunächst von der Geographie erschlossen und als bedeutsam markiert wurde. Im Verlag Olms Weidmann wird in Kürze ein Sammelband erscheinen, der das Interesse an Topologie im Bereich der höfischen Musikausübung auf seine Regionalität hin untersucht und inwieweit ein begrenztes Raumkonzept hier nach außen wirkte. Festmachen lässt sich diese Beobachtung anhand der Netzwerke und sozialen Beziehungen zwischen Herrschenden, Kunstausübenden und -produzierenden.

Raum – Hof – Musik, herausgegeben von einem Expertenteam um und mit Panja Mücke und Stefanie Acquavella-Rauch und bezeichnenderweise im Rahmen der Schriften der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mannheim, anknüpfend an die Tradition und das umfangreiche Quellenmaterial zur Mannheimer Schule und ihren Manieren.

Eingehende Informationen zu den heute wieder aktuell gewordenen Wechselbeziehungen zwischen Musikpädagogik und Musikwissenschaft, auch in ihrer diachronen Dimension, liefert der Band 11 der Reihe Kompendien Musik, für den die Expertinnen für die Musiklehre an allgemeinbildenden Schulen gleichermaßen wie in der Forschung, Claudia Breitfeld, Ute Jung-Kaiser und Brigitte Vedder verantwortlich zeichnen. Insbesondere wird diesem Verhältnis anhand von Betrachtungen und Analysen des heutigen Musikunterrichts, auch unter Schlagwörtern wie Inklusion und Nachwuchsgewinnung nachgegangen.