Welche Bewandtnis hatte es eigentlich damit, dass ein exzellent ausgebildeter und hochbegabter Pianist wie der Australier Percy Grainger seit seinem achtzehnten Lebensjahr in solchem Maße der Musik für Blasorchester anhing? Zwischen 1901 und dem Ende der 1950er Jahre verzeichnet sein chronologisches Werkverzeichnis wenigstens 33 Stücke kleineren und größeren Umfangs. Möglicherweise vermittelte ihm einen Teil der Faszination seine aus Adelaide kommende, von einer englischen Einwandererfamilie abstammende und kulturell gebildete Mutter oder er hatte als Heranwachsender in und um Melbourne häufig Marine- und anderen Militärmusikern zugehört und selbst sein Faible für deren Repertoire entwickelt.
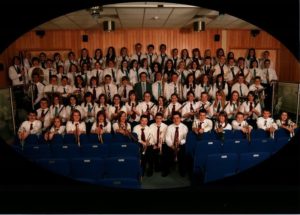
Seine hohe Virtuosität hatte es Percy Grainger schon als sehr junger Mann erlaubt, eine Konzertreise durch Europa anzutreten, das er so genau kennenlernte. In direkten beruflichen Kontakt mit Militärbläsermusik kam er nach seinem Umzug von London, wo er von 1901 bis 1914 lebte, in die USA, die 1917 in den Krieg eintraten: Er verdingte sich in der Armee freiwillig als Saxophonist und dirigierte bald selbst ein Militärorchester, mit dem er durch drei Kontinente auf Konzerttournee ging, um Mittel für Kriegskosten einzuwerben.

Nur ein gewisser Teil seiner Stücke für große „Wind Band“ war allerdings thematisch gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen oder innerhalb von Völkern gewidmet, auch wenn Märsche diese häufig latent implizieren; eine jetzt neu vorliegende Einspielung der 1916 gedruckten Partitur The Warriors ist wohl unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs entstanden, das höchst originell instrumentierte und durchgeführte The Lads of Wamphray (1905), das auf eine legendenhafte Fehde rivalisierender Familien an der schottischen Grenze im 16. Jahrhundert anspielt, ist beinahe noch ein Jugendwerk und ist eher von swingendem Jazz- als von Militärrhythmik geprägt.
Graingers mit mehr als zwölf Minuten Dauer längstes Stück für Blasorchester The Power of Rome and the Christian Heart, 1918 erstmals konzipiert, 1943 für Blasorchester neu gesetzt, rekurriert auf die Tatsache, dass die unter der Kaiserherrschaft unterdrückten Christen gezwungen wurden, im römischen Heer Kriegsdienste zu leisten – für den Komponisten eine Metapher der jungen Soldaten am Bajonett im Ersten Weltkrieg. Im Zuge seines durch Edvard Grieg früh geweckten Interesses am Sammeln von Volksliedgut stieß Grainger freilich nicht nur in England, sondern insbesondere in Dänemark, Schweden und Norwegen auf Melodien, die ihn faszinierten: So entstand etwa im Rahmen seiner Sätze auf dänische Volkslieder in den 1920er Jahren The Nightingale and the Two Sisters nach einer jütländischen Überlieferung.

In völligem Kontrast zur Militärmusik im engsten Sinn steht auch ein spätes Stück wie das überaus populär gewordene launige Country Gardens von 1953 oder ein vorweihnachtliches Angelus ad Virginem. Eine starke Tendenz hatte Grainger zur raffiniert kontrapunktischen Imitation von für große Kirchenräume angelegte Renaissance-Bläsersätze, wobei er den Kompositionen im Zuge der Durchführung gerne eine seiner Zeit gemäße expressionistische harmonische Färbung hinzufügte. Oft handelt es sich bei der direkten Bezugnahme auf Alte Musik, Bach-Werke zum Beispiel, um Bearbeitungen in dem Sinne wie sie auch Schönberg und Respighi vornahmen, ohne die gegebene Fortschreitung eines historischen Satzes anzutasten.