Musik will bekanntlich gehört werden. Allerdings scheint dieser Grundsatz durch gewisse Entwicklungen in den Digital Humanities an die Grenzen seiner Selbstverständlichkeit zu stoßen: Ebenso wie das Buch als Gegenstand von Wissenschaft keinen Leser mehr braucht, wenn es nur um das Auslesen und algorithmisch rationale Kombinieren von semantisierten Daten, das Feststellen der Kookkurrenzen von Wörtern geht, so kann auch Musik von einem Programm analysiert werden ohne zu erklingen, mithin die Maschine eine Partitur studieren und sezieren ohne dabei der Schallproduktion zu bedürfen … scheinbar jedenfalls …
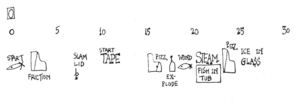
Trifft aber Musik das Ohr eines Zuhörers, so ist es heute ebenso wenig selbstverständlich, dass ihre „Botschaft“ auch emotional nachvollziehbar ist oder mit dem analysierenden Verstand erfasst werden kann. Traditionale Strukturen lösten sich vor mehr als siebzig Jahren mit radikal avantgardistischer Musik auf, die seit Beginn der 1950er Jahre häufig mit den Studioexperimenten elektroakustisch erzeugter Töne einherging; die Einbeziehung von (nieder- und hochfrequenten) Geräuschen, man denke an Stockhausens Licht-„Zyklus“ oder John Cages alternative Behandlung herkömmlicher Instrumente, erweiterte nochmals das Spektrum der Klangkünste; heute sorgt die Digitalisierung für eine perfektionierte Mimesis auch im Bereich des Programmierens.

Kann polytonale, avantgardistische oder so genannte aleatorische Musik nach Arnold Schönbergs Begründung des Serialismus überhaupt ins Herz oder ins Tanzbein treffen? An Dissonanzen statt Konsonanzen haben sich Konzertbesucher oder Filmzuschauer des 21. Jahrhunderts längst (zuvor) gewöhnt, doch das Hören zum Vergnügen scheint immer noch mit außermusikalischen Programmen, mit Synästhesien, mit Allusionen auf Bekanntes oder Rekombinationen verknüpft, selbst wo sich tonale Strukturen und sequentiell-logisches Komponieren verflüchtigt haben.

Dagegen galt in der Regel, man denke an J.S. Bachs Kunst der Fuge oder Beethovens späte Streichquartette, dem kompositionstechnisch kalkulierten Kunstwerk nicht die Gunst eines zeitgenössischen großen Publikums und man denke an den Skandal, den Schönberg 1913 mit der Aufführung seiner Kammersymphonie, von Werken Zemlinskys, Weberns und Bergs erzeugte, als er sich selbst bewusst und radikal von der Tonalität abzuwenden begonnen hatte und zunehmend abstrakt-logischen Formen den Vorrang gab. Der Reiz des Kreativen, Neuen, Ungewöhnlichen, Revolutionären zieht jedoch nach wie vor neugierige, aufgeschlossene Hörer in den Bann. Ohne diese Rezipienten wäre wohl die (glücklicherweise) relativ unvorhersehbare Entwicklung der Musik, der Künste überhaupt, an ihr Ende gelangt …