Neben dem Hinweis auf eine kapitalismuskritische kontexterschließende Studie der Philosophin Robin James zur Popularmusik des beginnenden 21. Jahrhunderts unter dem Titel The Sonic Episteme stellen wir hier ein in naher Zukunft erscheinender und zwei im November bereits vorliegende Fachbücher mit musiktheoretischem Anspruch vor.
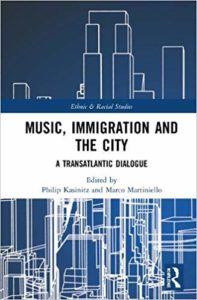
Das breite Spektrum immigrierter Musik fächert die für privat Interessierte leider nahezu unerschwinglich teure, inhaltlich aber lohnende, da global ausgerichtete Essaysammlung von Philip Kasinitz und Marco Martiniello auf, in dem Experten für die jeweilige folkloristische eingewanderte Musikszene en detail dichte Beschreibungen für ein Phänomen seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts liefern: Wie wird mexikanische Volksmusik in Los Angeles adaptiert, wie unterscheiden sich die Modelle von Hiphop im französischen Liège und im kanadischen Montréal, welche Besonderheiten weist Alevi unter in Deutschland lebenden Türken auf, wie setzten sich genuin karibische Soca-Stile im New Yorker Stadtteil Brooklyn fort und durch, was bestimmt jeweils die Ausprägung des Tango in seinen weltweit zahlreichen Diaspora-Regionen? Da nicht nur Musikwissenschaftler und Ethnomusikologen, sondern auch Sozialwissenschaftler an dem Projekt mitgewirkt haben, gewinnt die Beschreibung der Stilveränderungen einen zusätzlichen Rahmen: Lokalpolitische Maßnahmen – oder Unterlassungen – nehmen wesentlichen Einfluss auf die Etablierung und Veränderung der Szenen. Dass der Schwerpunkt einem bereits seit längerem selbst in den Künsten und Wissenschaften anhaltenden Trend zur „Landflucht“ folgt, ist dabei in Kauf zu nehmen, auch wenn der Band outback-regionale Aspekte themenbedingt ins Spiel bringt.

Die hier angestoßenen Aspekte komplementiert in gewisser Weise ein vom Generalsekretär des Instituts für Auslandsbeziehungen, Ronald Grätz, und dem Vorsitzenden des Deutschen Musikrats, Christian Höppner, herausgegebener Sammelband unter dem Motto „Meta. Macht. Musik.“. Die Autorinnen und Autoren versuchen die Möglichkeiten der akustischen Kunst zu ermitteln, Brücken zwischen Kulturen zu vermitteln, Frieden aufrechtzuerhalten und zu Demokratisierungsprozessen in Gesellschaften beizutragen. Schlaglichter werden aber auch auf die seit längerem diskutierte Kehrseite der Instrumentalisierung von Musik geworfen, nämlich in (Vor-)Kriegssituationen den Gruppenhalt zu bestärken, anzugreifen, aufzuhetzen. Im Vordergrund aber steht die Frage: Welchen konstruktiven Beitrag kann Musik in internationalen Beziehungen leisten?
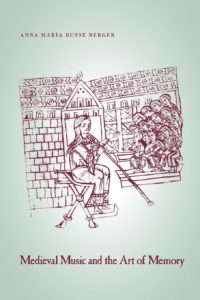
Der Verlag University of California Press edierte vor kurzem die lange erwartete und in den Ansätzen bereits vor 27 Jahren geplante Studie Medieval Music and the Art of Memory von Anne Maria Busse Berger. In provokanter Weise geht die Wissenschaftlerin mit einem seit Beginn des 19. Jahrhunderts gehegten Vorurteil rein schriftlicher Überlieferung von Musik im Mittelalter ins Gericht. Vorliegende Faksimiles und das Wissen über die Aufführungskultur geben Hinweise darauf, dass die Handhabung und Tradierung mehrstimmiger Musik zu einem großen Teil auf der Aktivierung des Gedächtnisses beruht haben muss. Viele Stimmbücher bzw. „Partituren“ wären demnach nicht verschollen, sondern schlicht nicht notiert worden. Die streng sektionale Teilung in einzelne Verse oder andere kleine Abschnitte ermöglichte durch Portionierung „in kleine Häppchen“ wohl das leichtere Memorieren. Die eng geführte Argumentation lässt ein neues Bild von der häufig als eindimensional wahrgenommenen Musik des Mittelalters entstehen.