Nicht hoch genug einzuschätzen in seiner Bedeutung ist der für August 2019 angekündigte und in seiner Art bislang einzigartige Historische Atlas Mittelalterlicher Musik, herausgegeben von Vera Minazzi, ihres Zeichens Musikpsychologin und Biomusikologin an der Universität Pavia und Cesarino Ruini, Professor unter anderem für Renaissancestudien an der Universität Bologna. Ziel der Publikation ist eine breite und lokalkulturell fundierte Reliefschärfung mittelalterlicher Musik unter Hinzuziehung von Experten benachbarter Disziplinen, Akustikern, Architekten, Historikern und Spezialisten für die Philosophie des Mittelalters.

Im Juni erschien von Thomas Christensen, Professor an der University of Chicago, bereits ein umfassender synchronoptischer Einblick in frühromantische Konzepte der Tonalität. Der Band Stories of Tonality in the Age of François-Joseph Fétis dokumentiert und analysiert zeitgenössische Vorstellungen von harmonisch-melodischen Standards über konkrete kompositorische Umsetzungen bis hin zu den theoretischen Ansätzen und bietet darüber hinaus vorausweisende Einblicke in die zukünftige historische Entwicklung. In gewisser Weise ging es um eine Manifestation der präsenten westlichen Praxis gegenüber den wohl in erster Linie von Wagner getragenen Einführung chromatischer Dissonanzen und „verquerer“ Modulationen, die die traditionellen Konventionen im Rahmen der Wiener Klassik und ihrer Überwindung in Mendelssohns Ära in Frage stellten. Als Lehrstuhlinhaber für Komposition und Harmonielehre am Pariser Konservatorium war der Belgier Fétis (1784 – 1871) allzeit ein kritischer Kopf und der maßgebliche Theoretiker französischer Musik seiner Epoche.

In produktiver Zusammenarbeit diskutierte der Bonner Musikwissenschaftler Tobias Janz mit dem in Taiwan lehrenden Fachkollegen Chien-Chang Yang die unterschiedlichen Konzepte von Moderne in der westlichen und fernöstlichen Musik auf Basis einerseits „kontaktloser“ historisch-theoretischer Bedingungen in beiden Sphären, andererseits der im 20. Jahrhundert angestiegenen globalen Einflussnahmen. Detaillierte Beobachtungen und Untersuchungen zeigen, wie lange und wie nachhaltig spürbar der kulturelle Eurozentrismus die Dichotomie zwischen Westlichkeit und Östlichkeit befördert hat.
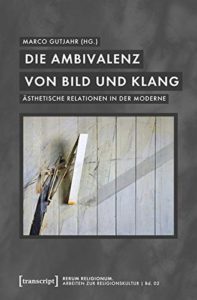
Beim Ausblick auf die zweite Jahreshälfte 2019 ist neben etlichen weiteren musikologischen Titeln nicht selten zusammenfassenden Charakters im Sinne von Handbüchern besonders auf die von Marco Gutjahr edierte weitgefächerte Aufsatzsammlung Die Ambivalenz von Bild und Klang: Ästhetische Relationen in der Moderne hinzuweisen, in der sich Forscher unterschiedlicher Disziplinen der festzustellenden Ambiguität von Bild und Klang in der Moderne nähern. Marco Gutjahr ist Bildtheoretiker, Literaturwissenschaftler an der Uwe Johnson-Forschungsstelle der Universität Rostock und Leiter der Kunststiftung Ruth Baumgarte in Bielefeld.