Zum ersten Mal überhaupt gastierte diesen Freitagabend Dirigent und Tanglewood-Professor Stefan Asbury am Theater Erfurt. Im Gespann mit dem einunddreißigjährigen ukrainischen Violinvirtuosen Valeriy Sokolov und dem perfekten Klangkörper des studioerfahrenen MDR-Sinfonieorchesters bot er seine ganz eigene Deutung von Sergej Prokofjews Konzert für Violine und Orchester Nr. 2 in g-Moll aus dem Jahr 1935.

Das zweifache Metrum als Besonderheit gerade dieses Werks fiel dank der unbeirrt präzisen Leitung kaum ins Gewicht, wurde nicht pointiert herausgearbeitet. Das war auch nicht vorgesehen, denn das Hauptgewicht verlagerte sich für den Zuhörer schnell auf den Einsatz des Solisten, das (namentlich im zweiten Satz Andante assai) kantilenenhafte und wie bei Prokofjew häufig folkloristisch basierte Melos, das permanent mit zeitgemäß modernen Einfällen korrespondiert. Dabei gelang Sokolov aber eine sehr konsequente personale Interpretation, die jene den Sätzen eingeschriebene „Verunsicherung“ geschickt überbrückte. Das abschließende und bizarr anmutende Rondo gelang ihm ebenso wie dem Orchester trotz der schwierigen Faktur nahezu spielerisch und unter vehementem Einsatz des Dirigenten in den Details.

Prokofjews Rückkehr in die Sowjetunion entsprach keinem Bedürfnis nach einer politischen Heimat, sondern einer Sehnsucht nach der russischen Sprache und Kultur, ähnlich wie sie, ohne allerdings Erfüllung zu finden, Rachmaninoffs Beziehung zu seinem Geburtsland bestimmte. Der Hang zu einem gewissen Folklorismus erklärt auch, warum tonale Strukturen in seinem Werk durchgehend erhalten bleiben, während gleichzeitig Strawinsky sie in den Hintergrund verbannte oder ironisch nutzte.
Beinahe konträr hierzu litt Dmitry Schostakowitsch unter dem sowjetischen Regime, unter dem es fast unmöglich war, mit der Entwicklung der Moderne Schritt zu halten, es sei denn unter dem Preis, sich dem Zugriff der Staatsaufsicht vorübergehend zu entziehen. Doch zielt das Programm seiner (ebenfalls in der Tonart g-Moll stehenden) 11. Symphonie, 1957 unter dem Eindruck des niedergeschlagenen Ungarnaufstands gegen die sowjetische Führung entstanden, mit seiner Allusion auf den Petersburger Blutsonntag 1905 durch zaristische Soldaten auf ein Allgemeineres, nämlich auf jegliche Form diktatorischer Repression unter Anwendung der „letzten Mittel“.

Die humanistische Botschaft aus der Erfahrung der Bedrohung und rücksichtslosen Ermordung der unter dem orthodoxen Priester Gapon demonstrierenden Arbeiter wurde in Stefan Asburys Interpretation überdeutlich: Der Apparat des Militärs gräbt sich in den Fortissimo-Passagen mit überbordendem Schlagwerk in die Gehörgänge und wird zur aufrüttelnden physischen Selbsterfahrung für die Zuhörer. Dass es sich beim Protest der Arbeiter um ein grundsätzlich gewaltloses Vorgehen handelte, resultiert für Schostakowitsch auch aus den verwendeten Kampfliedern, die im vierten Satz in den Vordergrund rücken. Die Machtmaschine des Militärs verdeutlichte das MDR-Sinfonieorchester, gelegentlich an der Grenze zwischen Perfektion (aus der Perspektive eines hohen Kunstgipfels) und Sterilität, durch den hämmernden und rhythmisch aufs Äußerste gleichmäßigen „Beat“ der Perkussionsgruppe nachdrücklich.
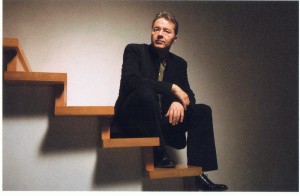
Die hochkomplexe Partitur ist für jeden Dirigenten eine spezielle Herausforderung und so gab sich Stefan Asbury nonverbal humorvoll, als er nach dem dritten Vorhang die Hände ans Ohr legte und so zum späteren Abend an die Notwendigkeit des Schlafs nach einem durchaus arbeitsreichen Tag erinnerte …
Schreibe einen Kommentar