In der zweiten Lieferung des laufenden Jahres lässt die Zeitschrift Die Musikforschung in erster Linie außerhalb Deutschlands angesiedelte Komponisten mit ihrem Werk zu Wort kommen – und hier überwiegend zu Aspekten des 20. Jahrhunderts. Das Themenspektrum ist allerdings so weit gestreut, dass Abwechslung beim Lesen und Studieren garantiert werden kann. Zusätzlich finden sich wie gewohnt zahlreiche Besprechungen neuer Noteneditionen und Buchtitel.
Mit einem Schwerpunkt auf der französischen und deutschen sinfonischen Orgelmusik nach 1870 und deren rezeptionsgeschichtlichen Interdependenzen untersucht Cordelia Miller ausführlich das entsprechende Repertoire Charles-Marie Widors und kontrastiert es mit dem sinfonischen Konzept bei Max Reger.

Die Übertragung einer profanen Gattung, der gerade in der „spätromantischen“ Phase eine herausgehobene Stellung zukam, auf die Orgel orientiert sich danach nicht an formalen Strukturen, sondern beruht der Übertragung von Monumentalität (wie sie ja auch ein großes Orchester leisten konnte) auf die sakrale „Königin der Instrumente“, sicher kein Zufall in einer Zeit nationaler Selbstbesinnung in Frankreich. Umgekehrt zu Widor konzipierte Reger seine Symphonische Phantasie und Fuge gerade mit dem Anspruch eines „Reinheitsgebots“ der symphonischen Idee.

Von glücklicher Kontingenz für das aktuelle deutschsprachige Musikschrifttum ist die Übernahme eines südosteuropäischen Beitrags über Serbische Salonmusik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, auf die Marijana Kokanović Marković im Rahmen einer umfassenden Forschungsarbeit interessante Seitenblicke gewährt. Ein serbisches Spezifikum innerhalb der musikwissenschaftlichen Erschließung der Balkanländer hat hierzulande durchaus Seltenheitswert und öffnet ein Fenster. Zunächst waren es, geht man auf die Wurzeln der nationalkulturellen Bewegungen zurück, ausländische Pädagogen, die im weiteren Umfeld ihres Klavierunterrichts Salonmusik komponierten, in denen sie häufig Melodien aus der serbischen Folklore verwendeten. Seit den 1840er Jahren schufen in Novi Sad wie in Belgrad Alois Kalauz, Morfidis Nisis und Josif Schlesinger die Voraussetzungen für die Entstehung eines (klassischen) Musiklebens. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs trugen auch zugezogene tschechische Komponisten zum Repertoire des Landes bei.
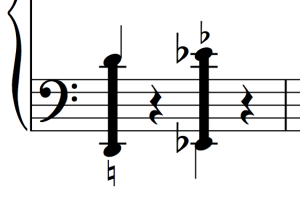
Zwischen sinfonischer Tradition und Experiment sieht Gregor Herzfeld die ersten beiden Sinfonien Henry Cowells von 1917-19 und 1938 angesiedelt. Bei dem 1897 im kalifornischen Menlo Park geborenen Violinisten und Pianisten handelt es sich geradezu um den Sinfoniker der US-amerikanischen Musik, der mit der erstaunlichen Zahl von 20 Sinfonien während seiner gesamten Schaffenszeit hervortrat. Unter sehr prekären Bedingungen, denn seine Inhaftierung in San Quentin aufgrund eines Missbrauchsvorwurfs erschwerte im Zuge der Konzeption der 2. Symphonie den Anschluss an das künstlerische Umfeld, aus dem Gregor Herzfeld vor allem Charles Ives und Charles Ruggles nennt. An deren ultramodernistische Ausrichtung, die durchaus eine Parallelerscheinung zu Schönbergs schockierender Durchsetzung der Polytonalität im europäischen Kontext darstellte, partizipierte er nicht. Vielmehr offenbart sein Erstlingswerk neben dem Hang zu einer vor allem in harmonischer Hinsicht experimentellen Ausrichtung doch auch traditionelle Züge wie im Finale die Struktur des Sonatenhauptsatzes. Eine nichtwestliche Rhythmisierung charakterisiert die 2. Symphonie neben Hymnik, Folklore und einer „romantische[n] Expressivität“ zusätzlich die Absicht einer therapeutischen Wirkung auf den „kranken“ Menschen der Zeit.

Ein durchaus überraschendes Schlaglicht wirft Natalia V. Gubkina auf die Liedkunst Frank Sinatras, dessen durchaus extensive Aufnahme und Verarbeitung europäischer klassischer Werke nicht jedem Musikhörer bekannt sein dürfte, wiewohl sie eigentlich aus Einspielungen evident sein müsste: Sinatras vielfältige Aneignungen illustrieren geradezu einen markanten Trend innerhalb der US-amerikanischen Musikindustrie und insbesondere der Repertoires der Jazz-Orchester ab 1921: die Orientierung an markanten Melodien aus Europa, zu denen nicht nur Rimski-Korsakows Hummelflug und Schumanns Träumerei, sondern auch Johann Strauß‘ Donauwalzer und Debussys La Mer zählen. Tommy Dorsey und Harry James mit ihren jeweiligen Orchestern nahmen sich der „Ohrwürmer“ aus der Alten Welt gar mit Vorliebe an. Frank Sinatra ging noch einen Schritt weiter, formte den 2. Satz aus Borodins 2. Quartett D-Dur in ein Swing-Stück um oder schrieb Our Love und Moon Love nach Themen von Tschaikowsky, dessen romantische Gefühlswelt der seinen offenbar sehr entgegenkam. Erstmals dokumentiert Natalia Gubkinas Auflistung aller verfügbaren Titel die erstaunliche Breite von Sinatras Adaptionen.

Die 3. diesjährige Ausgabe der Zeitschrift Musik und Ästhetik fällt, was die Thematik der Aufsätze betrifft, noch heterogener aus: Sie gelten Machauts Dissonanzen, dem Balladenliedkomponisten Carl Loewe und Violin-Solowerken Ole-Henrik Moes. Zur Diskussion stehen in dem Band die Schubert-Erkundungen von Julian Prégardien und der Briefwechsel zwischen Artur Schnabel und Therese Behr-Schnabel. Das erste Heft des Jahrgangs 2017 im Archiv für Musikwissenschaft aus dem Steiner Verlag bietet Beiträge zum Karaoke-Phänomen als typischer Erscheinung des beginnenden 21. Jahrhunderts ebenso wie zu Hindemiths kompositorischem Prozess und mit dem Erlebnis Operette (Michael Heinemann: Zur Historizität von Performanz). Abgesehen von der mangelnden Vertretung von Themen zur Musik des 16. und 17. Jahrhunderts lassen diese drei wichtigen deutschsprachigen Musikzeitschriften in der ersten Hälfte 2017 keine eindeutigen Trends erkennen: Die Aufsätze sind – wie kaum anders zu erwarten – Emanationen und Ergebnisse spezieller Forschungsinteressen, die als weitere Stücke zum vieldimensionalen „Puzzle“ der Musik und ihrer Rätsel(lösungen) beitragen.
Schreibe einen Kommentar