Selbst so bedeutende Kompositionslehrer wie Leonardo Leo und Francesco Durante hätten zu Beginn ihrer Karriere in Neapel wohl nicht im Traum damit gerechnet, welch nachhaltige Entwicklung ihr für damalige Verhältnisse exklusiver Stil in der Schülerschaft zeitigen würde. Die Rede ist hier unter anderen von Niccolò Jommelli, Giovanni Battista Pergolesi, Tomaso Traetta und Gian Francesco de Majo. Als erster hier soll Francesco Provenzale (1624 – 1704) einen Sonderweg eingeschlagen haben, etwa mit seinem Cicero, der ersten überhaupt aus der blühenden Metropole Kampaniens nach Venedig exportierten Oper, in der Folge mit La Stellidaura vendicante (1674) und Lo schiavo di sua moglie (1675). Neben Alessandro Scarlatti erhielt er allerdings erst im Jahr 1690 eine Stelle als Vizekapellmeister der königlichen Kapelle in Neapel.

Worin aber lagen die innovatorischen Züge dieser „Schule“ begründet? Auffällig ist, dass etliche Komponisten, die aus ihr hervorgingen, in physischer und geistiger Nähe zum Opernhaus wirkten und dass in der Aufschwungzeit um 1740 ein regelrechter Boom an komischen Musiktheaterproduktionen einsetzte, bedingt durch Pergolesis Einführung oder wenn man so will: Erfindung der Opera buffa, die auf der dialektsprachigen musikalischen Komödie Neapels fußte und schließlich das Entstehen eines „Intermezzo“ wie La serva padrona begünstigte, in dem die musikalische Gestaltung schon eine eminente Rolle spielte.

Ein Faible für das Komische eignete der Stadt Neapel nicht erst seit dieser Zeit, die in der Barockzeit ja auch eine Figur wie den (maskierten) Pulcinella hoffähig machte. Eine andere Kreation neapolitanischer Komponisten war die weltliche Kantate nach dem Vorbild von Alessandro Scarlatti, während in der Kirche mittlerweile durchaus konzertante Formen des Oratoriums ankamen, unter anderem wiederum dank Pergolesi.
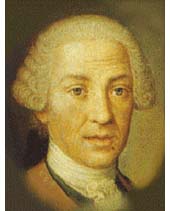
Was die Opera seria betrifft, so wurde hier die Reform Pietro Metastasios zu einem Muster für die Praxis in ganz Europa, in dessen Bann sich im deutschsprachigen Raum neben Hasse bekanntlich auch Gluck ziehen ließ: Die von Alessandro Scarlatti bereits angewandten Affekttypen der Arie nebst ihren Satzcharakteren – bravourös, parlierend und gemäßigt – etablierten sich ebenso wie die Beschränkung der agierenden Personen auf sechs und die Abfolgen von Rezitativen und Arien in einem Rahmen von drei Akten. In Venedig kannte man schon die Da-capo-Arie, die nun in Neapel in einer Form geläufig wurde, in der eine Sängerpersönlichkeit ihre Kunst durch Auskolorieren des Da-capo-Teils unter Beweis stellen konnte. Um 1760 reformierten Jommelli und Traetta die Opera seria nochmals, wobei sie die Rolle von Chor und Orchester stärkten.
Schreibe einen Kommentar