„Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus“, heißt es in einem schon vor 1233 beim Dichter Freidank belegten Sprichwort. Wenn man bei der ersten Bedeutung bleibt, stimmt dies aber nur im Falle von älteren Waldkulturen, denn Junganpflanzungen von Bäumen schlucken den Schall. In einer Landschaft mit hohen Felswänden und Höhlen funktioniert der Ruf nach der Nymphe Echo mit Bumerangeffekt bekanntermaßen zuverlässig.

Der Begriff des akustischen Phänomens Echo, das physikalisch vom Nachhall zu unterscheiden ist, wird in der Musik allerdings zunächst viel enger gefasst. So handelt es sich nicht, wie leicht zu vermuten wäre, um ein durchgängiges responsoriales Prinzip, wie es nach etlichen anderen Orlando di Lasso im Kanon anwandte, sondern meint einen vor allem in jeglicher Kunstmusik des 16. und 17. Jahrhunderts angewandten Kniff, der zum Zweck des symmetrischen Aufbaus eines Werks exzessiv „ausgebeutet“ wurde. Adriano Banchieri in seiner Fantasia in eco (1603) und Biagio Marini mit der Sonata in eco (1629) machten von der Imitation des reflektierten Schalls ausdrücklich instrumentalmusikalischen Gebrauch.
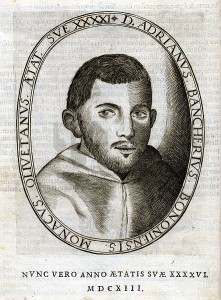
Schreibtechnisch gesehen gehört das Echo eher zu den einfachen Stilmitteln, da eine kurze Phrase lediglich in der höhergelegenen oder tieferen Oktave zu wiederholen ist, wobei in der Wiederholung häufig anders instrumentiert oder dynamisch variiert wird, um den Effekt zu verdeutlichen. Hin und wieder taucht das Echo sogar als Satzbezeichnung auf – wie am Schluss von J.S. Bachs Französischer Ouvertüre h-Moll aus der Clavier-Übung. Der Versuch, der Verformung des Klangs beim Widerhall zu entsprechen, äußert sich in älterer Musik aber eher selten als Verzerrung des soeben Gehörten; dies war wohl mehr in der dramatischen und lyrischen Literatur üblich, da hier auch das rhythmusbetonte Spiel mit der ironischen Brechung oder Verfremdung des ursprünglichen Sinns einer Aussage konkret(er) vermittelbar ist. Schon Euripides und Aristophanes hatten die Möglichkeiten des Echoeffekts als etabliertes Stilmittel in den elegoi echoikoi bzw. im später lateinisch so bezeichneten versus echoicus genutzt.

Abgesehen davon, dass bei Orgeln nach der Einführung des Registers Zartflöte auch das Cornet d’écho üblich würde, multiplizierten sich die komponierten Echo-Phrasen in der „Terrassendynamik“ bei Cembalo und Orgel. Nicht zu vergessen ist, dass gerade in der Oper mit antikem Sujet gerne davon Gebrauch gemacht wurde: Sowohl Purcell und Gluck im Hin und Wider des Duetts als auch viel später Richard Strauss in Ariadne auf Naxos setzten die vom Librettotext selbst vorgegebenen Möglichkeiten um.
Berücksichtigt man den übertragenen Sinn des genannten Sprichworts, so ließe sich die Zahl der Beispiele vor allem anhand des komischen Musikdramas vervielfachen, denn hier kommt noch der verfremdende Aspekt des Nachäffens zum Zweck der karikierenden Überbetonung, kommentierenden Beiseiteredens und der Bedeutungsverdrehung im semantisch manipulierten Echo hinzu – gerne angewandt bei Libretti nach dem Muster der Commedia dell’Arte und der Komödie Molières. Hier wäre vor allem an italienische Singspiele und Opern aus den Anfängen des 18. Jahrhunderts und noch an Mozarts (tragi)komische Opern zu denken.
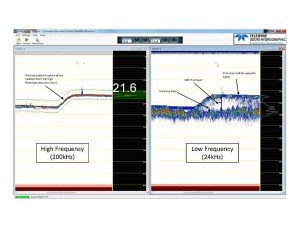
Lektüren zum Thema:
Joseph Löwenstein: Responsive Readings. Versions of Echo in Pastoral Epic, and the Jonsonian Masque. New Haven (Conneccticut) 1984.
Sebastian Schulze: Metamorphosen des Echos. Paderborn 2015.
Schreibe einen Kommentar