Leonard Bernstein und sein höchst rühriger Mentor Sergei Koussevitzky brachten von einer Israelreise zu Beginn der 1950er Jahre eine ganze Reihe aktueller Kompositionen mit. In den Vereinigten Staaten hatten sich die zuständigen Konzertveranstalter allerdings, wie uns Peter Gradenwitz informiert, fast ausschließlich für das klassische und romantische Repertoire interessiert. Nun aber galt es auch das Publikum mit weniger bekannten moderneren Werken bekannt zu machen.

Das Problem lag Sergei Koussevitzkys Aussage zufolge wohl in einer gewissen ignoranten Haltung der Orchester selbst, die zu dieser Zeit noch eine konservative Haltung vertraten. Dabei konnten es Paul Ben-Haims 1. Symphonie, die David-Sinfonie von Menahem Avidom, die Rhapsodie Emek von Marc Lavry und das Violakonzert Lobgesang des hochprofessionellen Bratschisten Ödön Partos aus Ungarn durchaus auch, bei teils unterschiedlicher Ausgangsposition, etwa mit Bernsteins Werken aus dieser Epoche aufnehmen. Die genannten Orchesterstücke erklangen, teils in Ausschnitten, bei der Tournee mit den Philharmonikern aus Israel in den Vereinigten Staaten und startete genau heute vor 66 Jahren. Koussevitzky, der aber bereits im Juni 1851 verstarb, hatte die Musiker in Israel selbst schon zwei Monate vorher auf ihre Auftritte vorbereitet, sein als Dirigent bereits erfahrener Juniorpartner seit Dezember 1950.
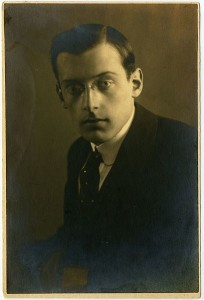
Am Berkshire Music Center wurde nicht der progressive junge Leonard Bernstein, wie es sich Koussevitzky eigentlich gewünscht hatte, sein Nachfolger, sondern der Elsässer Charles Münch, der 1946 die Leitung des Boston Symphony Orchestra übernommen hatte. Für den Schöpfer der West Side Story wurde 1851 schließlich trotz des Verlusts seines Förderers aber auch zu einem glückverheißenden Jahr, da er am 9. September die chilenische Halbjüdin Felicia Montalegre Cohn heiraten konnte, welche ihrerseits bei Claudio Arrau in New York ein angefangenes Klavierstudium fortzusetzen gedachte.

Aus heutiger Perspektive erscheint jener Begrenzungs- oder Zensurakt unverständlich, nämlich, dass das israelische Repertorie auf jeweils 12 Minuten Spieldauer (!) gekürzt werden sollte. Von der 1940 komponierten Symphonie Paul Ben-Haims, der 1931 wegen der nationalsozialistischen Politik aus Augsburg zur Auswanderung gezwungen worden war, spielte also das israelische Orchester auf seiner amerikanischen Reise nur den quasi autonomen Satz Psalm. Auch Mahler-Kalksteins alias Avidoms David-Sinfonie von 1948/49 konnte somit nur in Teilen aufgeführt werden.

Lobgesang von Ödön Partos, selbst leitender Bratschist im Israel Philharmonic Orchestra, der übrigens Yehudi Menuhin sein Violinkonzert widmen sollte, war offenbar für die Veranstalter der Orchestertournee nicht „zu lang“. Erstaunlich ist angesichts der schwierigen Durchsetzung des Repertoires aus Israel selbst in den USA, vor allem aber angesichts der Judenverfolgung im Dritten Reich, dass Bernstein später selbst sogar in Deutschland als Dirigent in Erscheinung trat.
Literatur(empfehlung):
Peter Gradenwitz: Leonard Bernstein. Unendliche Vielfalt eines Musikers. Neuausgabe. Mainz 2015.
Schreibe einen Kommentar