Was derzeit auf öffentlichen Bühnen jenseits des Atlantiks zu erleben ist, nämlich der Kampf um die Präsidentschaftskandidatur, ähnelt häufig genug einem Polit-Theater oder einer theatralischen Inszenierung des Politischen. Demgegenüber erscheinen die Resultate aus den Bemühungen um eine „wahrhaft“ amerikanische Oper seit 1900 eher harmlos. Worum es ging, war eine lange ins 20. Jahrhundert hinaus verschobene Selbstpositionierung. Denn an der Metropolitan Opera New York wie auch an anderen US-Opernhäusern bestimmte schon immer das traditionsbeladene italienische, französische und teilweise deutsche Programm den Betrieb. Und bis heute sind genuin amerikanische Opern vor allem dann erfolgreich, wenn sie auf Stoffe und die Dramaturgien populärer Filmproduktionen zurückgehen; doch auch hier ist weder die Grenze zum Musical noch zu anderen Tanztheaterformen scharf zu ziehen.

Auf eine weitere Festigung der europäischen Oper insbesondere Verdis, Händels und Berlioz‘ in den USA zielte die Kulturpolitik der 1950 von zwei jungen Musikern der Juilliard School begründeten American Opera Society. Ursprüngliches Anliegen war jedoch die Wiederbelebung des Musikdramas aus dem Geist der Renaissance, dem sich die Initiatoren mit Monteverdis L’Incoronazione di Poppea als erster Aufführung der Gesellschaft verpflichtet sahen. Es ging im weiteren um die Aufführung bisher in der Neuen Welt vernachlässigter Werke, so auch Glucks Le cadi dupé. Nach dem Erfolg von Donizettis La Fille du Regiment mit Beverly Sills an der „Met“ musste der Leiter das große Gesamtprojekt aus finanziellen Gründen 1970 leider aufgeben.
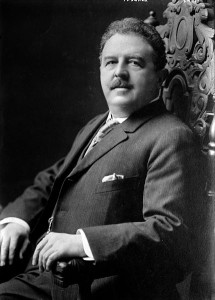
Auch den vier amerikanischen Opera Companies war wenig Dauerhaftigkeit beschieden: Die erste von ihnen wurde 1886 unter der Patronage von Jeannette Meyer Thurber, eine zweite konnte wegen des Börsencrashs an der Wall Street 1929 nicht weitergeführt werden, das vierte Projekt endete 1950. Dies bedeutet allerdings keineswegs, dass sich die Oper – neben dem Musical und der Jazzoper(ette) – nicht seit den Anfängen im 19. Jahrhundert einen hohen Stellenwert mit großem Engagement und ein interessiertes Publikum gesichert hätte. 2010 erfuhr Gene Sheers Moby-Dick auf der Basis von Bernard Herrmanns einem originär amerikanischen Stoff gewidmeter Konzert- und Filmmusik aus dem Jahr 1838 auch außerhalb der Dallas Opera, an der das Stück inszeniert wurde, weitreichenden Zuspruch.
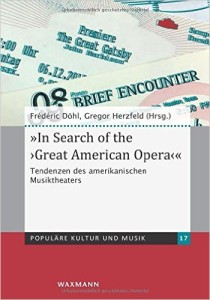
Elemente einer spezfisch „amerikanischen“ Idiomatik in der musikalischen Sprache fanden sich bereits in Arthur Nevins Poia (1910), mit Frederick Shepherd Converses The Sacrifice (1910), Victor Herberts Natoma (1911) und Mary Carr Moores Narcissa (1912). Diesen Musikdramen liegen sowohl „verspätete“ nationalromantische Bezugnahmen als auch das Rekurrieren auf die Kultur der Indianer als Ureinwohner zu Grunde. Eine Theatralisierung des Politischen im New Deal konnte Marcus Gräser als Merkmal von Aaron Coplands Oper The Second Hurricane (1936/37) ausmachen. Street Scene und das opernnahe Musical West Side Story von Leonard Bernstein diente, wie Nils Grosch kürzlich zeigte, wenigstens zum Teil der „kompositorischen Selbstinszenierung“ und definierten die auch unter multikulturellen Vorzeichen zu verteidigenden „Werte“ der US-Gesellschaft zwischen 1946 und 1957.
Schreibe einen Kommentar