Den Verfechtern einer genuin britischen wissenschaftlichen Methodik muss der Ansatz des namhaften tarentinischen Philosophen aus dem vierten vorchristlichen Jahrhundert sehr verlockend erschienen sein. Die von Aristoxenos entworfenen Parameter einer Musiktheorie folgen nämlich strenger Empirie. Dies impliziert, dass er der Wahrnehmung von Tönen durch das Gehör höchste Priorität einräumte. Aus diesem Grunde beschrieb er mit einem seiner erhaltenen Hauptwerke auch die „Harmonie der Elemente“. Nur konsequent war es daher auch, dass er die Definition von Tonintervallen alleine durch Zahlenverhältnisse, wie sie Archytas mit seinen Tetrachordberechnungen und die Theoretiker in dessen Umfeld betrieben, ablehnte. Er hielt ihre Methoden für zu ungenau. Seine eigenen Axiome und Kalkulationen beruhten vielmehr auf der Größenlehre des ein bis zwei Generationen älteren Philosophen, Astronomen und Mathematikers Eudoxos von Knidos.
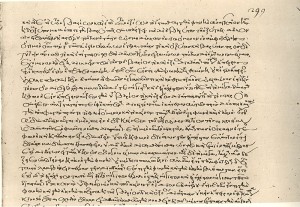
Aristoxenos‘ Genauigkeitsanspruch im Messen und Rechnen führte schließlich dazu, dass er als erster eine sehr konkrete Definition des Intervalls, das er διάστημα, also „Zwischenraum“, „Entfernung“ nannte, unternahm; jedem dieser Intervalle wies er eine exakt ermittelte Größe zu, die mit der geometrischen Ermittlung von Strecken zu vergleichen ist. Aus der Teilung des Axioms τόνος, dem „Ganzton“, ergaben sich Halbtöne, die später nicht mehr gebrauchten Dritteltöne und Vierteltöne. Die heutigen Intervallproportionen, wie sie an der Klaviatur nachzuvollziehen sind, gehen auf die von ihm festgelegten Intervallporportionen zurück, so die Zusammensetzung der Oktave aus Quinte und Quarte.
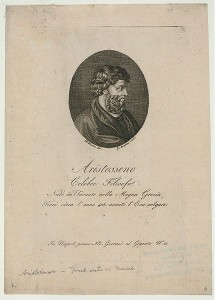
Ebenso fußt die (nicht nur) im westlichen Denken etablierte Rhythmik auf seinem Parameter χρόνος, der Dauer hörbarer Ereignisse. Analog zu den Primzahlen definierte er so eine Primdauer als kleinster unzerlegbarer Einheit. Demnach ergab sich das, was wir heute unter Rhythmus verstehen, als „Dauerfolge“, die er an Körperbewegungen – vielleicht ähnlich unserem Begriff von Tanzschritten – exemplifizierte. Die Untereinheiten des Rhythmus, möglicherweise vergleichbar mit dem, was wir heute als Metronomschläge erfassen, teilte er in sieben Kategorien ein. Leider ist aber aufgrund des verlorenen Quellenmaterials nicht mehr nachvollziehbar, wie diese genau beschaffen waren.
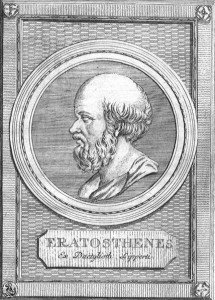
Über seine Kritiker, insbesondere Eratosthenes und Ptolemaios, gelangte Aristoxenos‘ Begrifflichkeit zu Boethius und damit in die Sphäre christlichen Denkens, das im Mittelalter die Systematik der Kirchentonarten hervorbrachte. Die Gegnerschaft zu Pythagoras‘ Lehre, auf denen aber sein eigener Hang zur mathematischen Präzision beruhte, ließ den Empiriker fälschlich noch im 18. Jahrhundert als antimathematisch argumentierenden Theoretiker erscheinen. Bei aller Bodenhaftung und Genauigkeit seiner Forschungen war ihm dennoch der Rest des Unbestimmten, Unmessbaren, verwandt mit Anaximanders ἄπειρον, voll bewusst: Er nahm sowohl in seiner Intervall-, Harmonie- als auch Rhythmustheorie inkommensurable Größen mit irrationalen Proportionen als gegeben an. In einem zeitlosen Verständnis bleibt seine auf dem Experiment beruhende Denkweise allemal „modern“, zumal er dem Gehör ein selbstständiges Urteil einräumte, auch jenseits von logischer Berechenbarkeit.
Schreibe einen Kommentar