Zum wiederholten Mal saß am Donnerstagabend anlässlich des 10. Symphoniekonzerts der Saison als Gast Marko Nikodijevic im Publikum des Erfurter Opernhauses. Seine dem Umfang nach recht knapp gehaltene Motette exaudi / bruckner Abglanz nach dem 54. Psalm des Alten Testaments schrieb er mit 20 Jahren und kann sie daher zu Recht heute als Ausdruck einer jugendlichen Sturmzeit unter der geistigen Ägide Bruckners deuten. Dennoch hängt der Komponist bis heute an dem kleinen, durch individuelle Instrumentierung auffälligen Vokalwerk mit Orchester; so spielen die nach Harfenmanier gezupften Klaviersaiten darin eine wichtige Rolle.
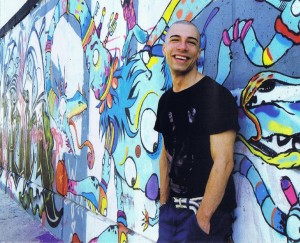
Sieben Jahre nach seiner Entstehung korrigierte Nikodijevic einige Stellen in der Orchestration und bei der Stimmführung. In rhythmischer Hinsicht ist exaudi streckenweise von einprägsamer Einfachheit, dramaturgisch zweigeteilt, sorgt aber aufgrund der Kontrastierung von Mezzosopranstimme, Kinderchor und einer sehr eigenwilligen Behandlung des Orchesterapparats für etliche Überraschungen.
Mezzosopranistin Katja Bildt, die schon mit Madama Butterfly als Suzuki in einer Glanzrolle zu erleben war, vermochte die anspruchsvolle Partitur hier ebenso überzeugend umzusetzen wie im Kleid der Klementia in der anschließenden konzertanten Kurzoper Sancta Susanna von Paul Hindemith aus dem Jahr 1921. Der melodramatisch gestaltete Stoff aus dem grau(s)en Mittelalter und der nicht viel helleren frühen Neuzeit missfiel Kritikern bei der zusammen mit zwei anderen Einaktern geplanten Uraufführung und schaffte daher erst 1922 in Frankfurt den Weg auf die Bühne.

Sein Thema ist die Obsession der religiösen Liebe ebenso wie der richtenden Kirche. Julia Neumann verkörperte dabei mit überwiegend elegisch rezitierender Sopranstimme Susanna, der das Schicksal der Einmauerung ebenso wie einer der Nonnen vor ihr droht. In schwarzen Gewändern treten Katharina Walz als alte Eminenz des Klosters und ihre Mitschwestern auf, um die Verdammung auszusprechen.
Als lichter Gegensatz hob sich hiervon nach der Pause Bruckners Symphonie Nr. 7 in E-Dur ab. Denn in keiner anderen gelang diesem eine im Hinblick auf Melodik und Strukturgebung so transparente und „kompakte“ Ausarbeitung eines Eingangssatzes. Das von Optimismus und romantischem Grundgefühl beseelte Werk hatte das Glück, sich auch im Ausland bald durchzusetzen, nicht zuletzt dank des hohen Einsatzes solcher Dirigenten wie Friedrich Schalk und Artur Nikisch.

Das Hauptthema des vierten Satzes dieser Symphonie zeigt nicht zufällig Ähnlichkeiten mit dem Eingangsthema des ersten, wodurch er auch der klassischen symphonischen Form nach eine abschließende Klammer bildet. Kein Zufall ist es also, dass parallel dazu die äußeren Klammern dieses Konzertabends Bruckner-Referenzen darstellen.
Dank der „Lesart“ von Dirigent Samuel Bächli, der explizit auf die nachträglich eingefügten Tempoangaben anderer ebenso verzichtete wie auf den von fremder Hand hinzugetupften Beckenschlag im Adagio-Satz, erschienen die entwickelnden Teile der ausladenden Symphonie fließend wie auch solistische Partien der Klarinette etwa oder der Hörner in Verbindung mit den Tuben klar exponiert. Den wuchtigen Höhepunkt bildeten die prägnant herausgehämmerten letzten Takte des sehr geschwinden Scherzos.
Schreibe einen Kommentar