Prominenteste Beispiele finden sich in Henry Purcells Orchesterkompositionen: Seit dem 15. Jahrhundert, aber in anderer Form sicher vorher schon gepflegt, taucht ein gleichermaßen in Wales wie in Schottland gebräuchlicher Tanz durch Erwähnungen aus dem Dunkel der Musikgeschichte auf. Die Hornpipe wurde seit den Anfängen ihrer Aufzeichnung in ungeradem Takt notiert, etwa ab 1760 begegnet sie auch in geraden Taktarten.

Seinen Ursprung hat der geschwinde Tanz selbstverständlich im gleichnamigen Blasinstrument, das entweder mit einem oder zwei Rohrblattmundstücken gespielt wird und dessen Schalltrichter aus einem Tierhorn oder auch einem Huf besteht; die Pfeife wurde schließlich auch bei den aufkommenden Sackpfeifen verwendet. Möglicherweise handelt es sich um ein ursprünglich keltisches oder keltiberisches Instrument, denn neben dem frühen Vorkommen in Wales unter der Bezeichnung Pibgorn – mit sechs Grifflöchern und einem Loch für den Daumen – findet sich die Hornpipe im Baskenland wieder: Die hier beheimatete Alboka mit prinzipiell zwei Rohren, die links über fünf und rechts über drei Grifflöcher verfügen, wurde bereits im 13. Jahrhundert erwähnt. Der Name leitet sich vom arabischen Wort al-bûq für Trompete oder Signalhorn ab.
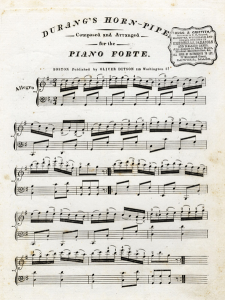
Exhibitions/Dance/, US p.d.).
Vor der kunstmusikalischen Entwicklung, die vom sportiven Tanz wegführte, nämlich im 15. und 16. Jahrhundert, verstand man unter der Form einen Rundtanz, der grundsätzlich von Paaren ausgeführt wurde. Seine Wurzeln hatte dieser in den ländlichen Regionen sowohl der britischen Insel als auch Irlands. Nach dem Handbuch Morality of Wisdom von 1480 wurde er von drei als „galante“ Damen kostümierten und drei als „Matronen“ verkleideten Frauen aufgeführt. Hugh Ashtons notierte Hornpipes, die vor 1522 entstanden, sind bereits vom Rundtanztypus emanzipiert. Bei John Ravenscroft (1650 – 1708), einem wahren Corelli-Schüler im Geiste – oder doch auch in der Wirklichkeit? – fand die nunmehr weitgehend frei genutzte Form Eingang in die Triosonate und in derselben Epoche nahm Purcell die Hornpipe als modisches Instrumentalstück im Rahmen der Suite in nahezu alle seine Theatermusiken auf.

Ein populäres Exempel lieferte Georg Friedrich Händel in der Suite No. 2 seiner Wassermusik, wobei der Reiz hier darin besteht, dass nach zwei miteinander kontrastierenden Motivteilen aus dem zweiten weitere Sequenzen entwickelt werden, die sich schließlich sozusagen verselbstständigen. Plastisch nachzuverfolgen ist dies an dem sehr anschaulichen Strukturschema, das Reinhard Amon in Verbindung mit Gernot Gruber in seinem Lexikon der musikalischen Form vorstellt.
Schreibe einen Kommentar