Nicht nur rhythmisch präzise, von Anfang an mit vollem Einsatz und mit behutsamen Gesten dirigierte Hermes Helfricht, Pianist, Sänger und derzeit Zweiter Kapellmeister am Theater Erfurt, die voller Subtilitäten steckende Partitur einer weiter mustergültigen Carmen-Inszenierung. Dies zeichnete sich vor allem bei den allseits vertrauten „Publikumsschlagern“ ab, die nicht herausposaunt wurden, sondern in denen jedem Detail in der Instrumentation gebührende Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Das Philharmonische Orchester der Landeshauptstadt sorgte am gestrigen Sonntagabend wieder mit seidigem Glanz für besonders elegante und timbriert strahlende Klanggemälde, in denen auch kleinste solistische Nuancen – wie des Fagotts, der Trompete oder der Harfe – deutlich herausgearbeitet waren.

Das gleichermaßen ausdrucksvolle Spiel der Musiker passte in idealer Weise zu einem Regiekonzept, das Bernard Uzan in Verbindung mit Hank Irwin Kittel nach der kritischen Ausgabe und unter Kürzungen der Dialogfassung in einer optimierten Version geschaffen hat. Dass Prosper Mérimées Novelle und George Bizets dreißig Jahre erfolgte musikdramatische Umsetzung großen Teils eine französisch imaginierte spanische Lebenswelt vorführte, versuchte unter anderem das Bühnenbild mit dem häufig eingesetzten Schleiervorhang zu verdeutlichen. Den Tanzauftritten der Zigeunerinnen im Gasthaus fehlte es lediglich an der typischen darstellerischen Spontaneität und Leidenschaft, die ihnen attestiert wird, und die Stimmen des Kinderchors hätten etwas mehr Umrissschärfe vertragen können.
Der Aufführung als ganzer gelang es, die Brüche zwischen ariosen oder chorischen Szenen und den Rezitativen – wie sie etwa bei einer Mozart-Oper als selbstverständliche Konvention hingenommen werden – zu „kitten“, indem die ankündigenden Akkorde dramaturgisch stimmig und ohne lange Zäsurpausen intoniert wurden.

Eine sehr glückliche Überbrückung zwischen Ouvertüren und Bühnenhandlung bildet der Einsatz von Goya-Gemälden auf dem transparenten Vorhang mit bedeutungsvoller akzentuierender Beleuchtung, der die schon für Mérimées literarisches Umfeld typische Vorausdeutungstechnik berücksichtigt. Thomas Hase gelang außerdem ein ständig präsentes und changierendes Lichtdesign, das die musikdramatische Handlung konzentriert begleitet und Spannung erzeugt: So deuten glühwürmchenartige Laterneneffekte den mühsamen, in Serpentinen verlaufenden Weg der Schmuggler über die Berge im dritten Akt an.
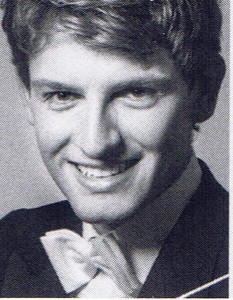
Vom Publikum wurde dieser Carmen-Abend zu Recht mit lange wiederholten Beifallsbekundungen bedacht. Was die sängerischen Qualitäten betrifft, sei neben der großen Leistung der Amerikanerin Aurore Ugolin als Carmen und Thomas Pauls als Don José der klare voluminöse Bariton Valeri Turmanovs in der Rolle des Toreros Escamillo hervorgehoben. Letzteres gilt in noch gesteigerter Form für Daniela Gerstenmeyers Übernahme der Figur der fürsorglichen Botin Micaëla, Carmens Nebenbuhlerin, die Don José an seine Pflichten als Sohn einer sterbenden Mutter erinnert und ihn aus der dämonisch interpretierten Sphäre der Zigeunerin zu befreien sucht. Die Freiheit des Zigeuners als Maß aller (seiner) Dinge muss aus heutiger Sicht als eine ähnlich klischeehafte Zuschreibung verstanden werden, wie sie noch in dem der Erzählung vorhergehenden Jahrhundert das Bild vom „edlen Wilden“ kennzeichnete. In der Wirklichkeit resultiert diese vermeintliche Freiheit der „Gitanos“ aus deren gesellschaftlichem Ausschluss.
Schreibe einen Kommentar