Der Raga, klassisches Mittel der Improvisation, vergleichbar in dieser Funktion den Psalmodien, aber durchaus komplizierter, hatte seinen Ursprung im Samaveda, dem Gesang der Priester. Dadurch entstand ähnlich wie auf dem europäischen Kontinent in Indien die Kunstmusik im religiösen Bereich und verfeinerte sich bis heute immer weiter. Trotz der anderen Position des Ausführenden, der immer gleichzeitig Komponist eines völlig neuen Stücks ist, gibt es feste Regeln, etwa, was die („harmonischen“) Modi und den Rhythmus betrifft, der nicht zuletzt durch ein Perkussionsinstrument gesteuert wird. Überwiegend kennt die indigene klassische Musik des Subkontinents solistische Konzerte, die bei aller Freiheit der Komposition doch streng geregelt sind.

Seit es in Europa notierte Musik gibt, erlaubt die Ausführung der vorgeschriebenen Melodiestimmen wenig Spielraum – im Gegenteil: Durch Vorschriften in Dynamik und Tempo wurde die Solistin oder der Solisten in seinen Gestaltungsmöglichkeiten immer mehr eingeschnürt, insbesondere in europäischer, vor allem spätromantischer Musik am Ende des 19. Jahrhunderts, aber auch in avantgardistischer Musik nach dem Zweiten Weltkrieg und in Tonbandrealisationen, die die Aufnahme selbst der Komposition gleichstellten. Dies wäre bei der klassischen indischen Musik nicht denkbar: Der spielende Komponist hat seine Kunst sowohl als Ausführender am Instrument als auch in der „spontanen“ Entwicklung der Strukturen seines Stücks zu erweisen; kein „allwissender“ Dirigent oder Partiturdiktator steht vor bzw. hinter ihm.
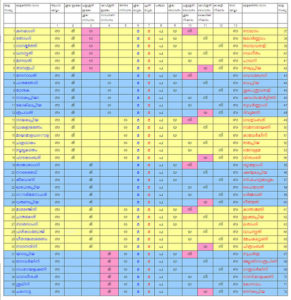
Gleichwohl gab es gerade in den letzten vierzig Jahren vielfältige Bemühungen, die Sphären so völlig verschiedener Musikkulturen wie der indischen mit ihrer ganz anderen Notation und Systematik und der auf Kirchenmusik basierenden europäischen einander anzunähern. Erleichtert wurde die Kommunikation in den letzten Dezennien durch Weltmusik, in der die Fusion unterschiedlicher Stile und Tonsysteme eine (nicht ganz neue) Normalität darstellt, wenn nicht diese überhaupt konstituiert.
Dass dies auch in der Klassik funktioniert, zeigt anschaulich die Laufbahn des Geigers Lakshminarayana Subramaniam: In Ceylon 1947 geboren wurde er sowohl in der traditionellen karmatischen Lehre Südindiens unterwiesen als auch in der europäischen Kunstmusik.
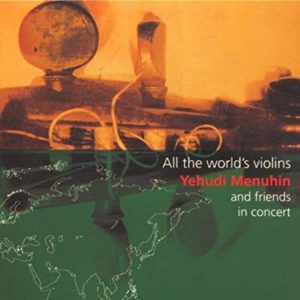
Noch erstaunlicher ist, dass er in seine Auftritten und Kompositionen gleichermaßen und teilweise auch gleichzeitig die Musiktraditionen beider Welten praktiziert. Er schrieb Symphonien und realisiert(e) beinahe synchron karmatische Projekte einschließlich Abhandlungen über diese, schrieb die Filmmusik zu Salaam Bombay und Mississippi Masala. Die Geige spielte er ebenso in Bertoluccis Little Buddha wie in Cotton Mary. Subramaniam arbeitete mit Yehudi Menuhin zusammen, mit Herbie Hancock, Musikern des Fusion Jazz ebenso wie mit dem Jazz-Violinisten Stéphane Grappelli und dem klassischen kalifornischen Geiger Ruggiero Ricci.